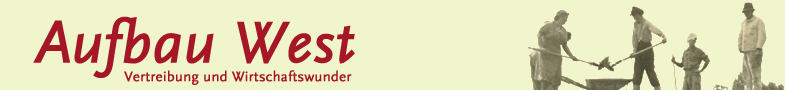Beginn des Inhalts/Link zum Seitenanfang| Link zur Seitennavigation|
Vertriebene Frauen im Aufbau West: „... und es war nicht anders möglich, als dass ich dann das Schneiderhandwerk lernte. Da wurde gar nicht lange gefackelt.“
- Öffentliche Erinnerung
- Flucht und Vertreibung
- Frauen im Aufbau West
- Berufswahl
- Frauenbilder
- Biografien
- Fußnoten

Öffentliche Erinnerung
Die Bilder aus der Zeit des eigentlichen Wiederaufbaus zeigen jedoch fast nur Männer: Der Wiederaufbau wird medial vor allem mit den männlichen Arbeitern in der Montanindustrie – den Bergleuten und Stahlarbeitern – verbunden. Erst in den Werbefotos und Illustrierten der 1950er Jahre werden Frauen wieder sichtbar – nun aber als Konsumentinnen: Nach der neuesten Mode gekleidet genießen sie in modern eingerichteten Wohnungen das „Wirtschaftswunder“.
Angesichts dieser überlieferten Bilder stellt sich die Frage, wie das Leben von Frauen in der Zeit dazwischen, zwischen Kriegsende, Flucht, Vertreibung und Nachkriegselend einerseits und neuem Wohlstand andererseits aussah. Beschränkte sich ihr Beitrag zum Wiederaufbau auf die Beseitigung und Aufbereitung von Trümmern? Inwiefern unterschied sich die Situation von geflüchteten und vertriebenen Frauen von der einheimischer Frauen? Sind sie wirklich in den fünfziger Jahren wie selbstverständlich zur alten Rolle der Hausfrau und Mutter zurückgekehrt und überließen die Erwerbsarbeit den Männern?
Tatsächlich begann das „Wirtschaftswunder“ für viele Frauen erst viel später. Die fünfziger Jahre waren weiterhin geprägt von harter Arbeit und dem Bemühen um eine gesicherte Existenz für eine bessere Zukunft.1 Belegt ist, dass die Erwerbsquote von Frauen auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter anstieg.2 Es mangelt allerdings an Untersuchungen, die sich speziell mit der beruflichen Situation von geflüchteten und vertriebenen Frauen zwischen 1945 und 1961 beschäftigen.3 Eine erste Archivrecherche in den Akten des Landesarbeitsamtes von Nordrhein-Westfalen und in denen der lokalen Arbeitsämter im Ruhrgebiet ergab zudem, dass in der Vermittlungsarbeit kaum zwischen einheimischen und zugezogenen Frauen unterschieden wurde. Das erschwert die Untersuchung der beruflichen Lebenswege der Frauen aus Flüchtlings- und Vertriebenenfamilien. Einen ersten Zugriff bieten jedoch die seit Mitte der 1980er Jahre zahlreich erschienenen Publikationen zur Nachkriegszeit, die auf Oral-History-Projekten basieren. Sie geben Einblicke in die ökonomische und soziale Situation von einheimischen und zugewanderten Frauen gleichermaßen.4 Wie die in der Ausstellung „Aufbau West“ präsentierten Biografien 5 zeigen sie in den individuelle Lebenswegen gleichzeitig typische Entwicklungen auf.
Flucht und Vertreibung
Die meisten der in „Aufbau West“ vorgestellten Frauen erlebten das Kriegsende als Kinder und Jugendliche und erinnern die Zeit der Flucht und Vertreibung als traumatischen Einschnitt. Auch wenn sie zum Zeitpunkt des Aufbruchs noch sehr jung waren, so haben sie alle noch die Angst ihrer Mütter und Schwestern vor Übergriffen durch sowjetische Soldaten vor Augen sowie die teilweise schlimmen Szenen, die sich im Überlebenskampf auf der Flucht abspielten.6 Hinzu kam die Ungewissheit, was mit ihnen geschehen würde. So schildert Frau Koch-Thalmann: „Es hätte auch Sibirien sein können [...], was vielleicht sogar verständlich gewesen wäre, nachdem was sich da in den Dörfern abgespielt hat, oder aber ja, in den Westen. Und wir wussten ja, dass im Westen alles kaputt ist. Und wie da dann ein Leben statt finden sollte, das konnten wir uns auch nicht vorstellen. Man konnte sich weder das eine noch das andere vorstellen.“7
Für viele Familien gab es allerdings keinen direkten Weg nach Westen. Die Flucht von Frau Neumann mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern aus Ostpreußen endete zunächst in der Nähe von Danzig. Sie bekamen keinen Platz mehr auf einem der Flüchtlingsschiffe und erlebten das Kriegsende in Westpreußen. Während die Mutter und die ältere Schwester auf einem polnischen Gut gegen geringen Lohn arbeiteten, passte Frau Neumann auf ihre jüngeren Geschwister auf. Zusätzlich musste sie in einer Schule putzen, ohne Bezahlung. Erst 1947 konnte die Familie nach Deutschland ausreisen.8
Frau Tetzlaff erlebte das Kriegsende als Bäuerin in Westpreußen. Sie kam ursprünglich aus Bessarabien. Im Zuge des Deutsch-Sowjetischen Nichtangriffspakts von 1939 wurde dieses Gebiet der sowjetischen Interessenssphäre zugeschlagen und die Bessarabien-Deutschen mussten 1940 ihre alten Siedlungsgebiete verlassen. Die NS-Regierung wollte diese sogenannten „Volksdeutschen“ in den eroberten polnischen Gebieten ansiedeln, um diese zu „arisieren“. So erhielt auch das Ehepaar Tetzlaff in Westpreußen einen Hof, dessen ehemalige polnischen Besitzer zuvor in das neue Generalgouvernement vertrieben worden waren.9 Nach dem Einmarsch der Roten Armee wurde ein Teil der in Polen verbliebenen Deutschen festgehalten und zur Zwangsarbeit eingesetzt. Frau Tetzlaff musste vor allem im Straßenbau arbeiten und erinnert sich: „Wenn Sie die großen Walzen kennen auf der Straße im Straßenbau, die mussten wir Frauen schleppen, ziehen, auf der Straße. Das war meine schwerste Zeit, die ich überhaupt hatte.“10 Schließlich wurden sie und ihre Tochter 1947 zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion verschleppt – bis nach Tadschikistan, in die Nähe der afghanischen Grenze. Acht Jahre lebte sie hier mit mehreren russlanddeutschen Familien auf einer Kolchose und musste täglich 60 Kilogramm Baumwolle pflücken. Wenn die Erntezeit vorbei war, hoben sie Bewässerungsgräben neu aus. Erst 1955 durften Frau Tetzlaff, ihre Tochter und ihr Sohn ausreisen.
Neben den traumatischen Erfahrungen von Flucht, Leben unter polnischer Verwaltung und Vertreibung sind den Frauen vor allem die Reaktionen der Einheimischen bei ihrer Ankunft im Westen nachhaltig in Erinnerung geblieben. Frau Netzer, die Anfang 1945 mit ihren Eltern aus Pommern geflohen ist, erzählt von feindseligen Reaktionen, die auch noch Jahre später zu spüren waren: „Also wir waren überhaupt nicht gut angesehen. So Flüchtlinge, das war eben fast das Allerletzte.“11 Auch die anderen Frauen berichten, dass ihnen die Einheimischen noch lange Ablehnung entgegen brachten: in der Familie des Ehepartners, in der Schule oder in der Berufsschule.

Frauen im Aufbau West
Im Krieg waren ca. 3,7 Millionen deutsche Soldaten umgekommen und noch einmal 11,7 Millionen gerieten bei Kriegsende in Gefangenschaft.12 Zudem galten etwa 2 Millionen Männer als kriegsversehrt.13 So trugen zahlreiche Frauen nach Kriegsende die Hauptlast der Existenzsicherung ihrer Familien. Das galt in besonderem Maße für alleinstehende Frauen, Flüchtlings- und Vertriebenenfrauen, aber auch für ausgebombte Einheimische. Frauen arbeiteten in fast allen Berufen, vor allem aber in der Landwirtschaft, im Textilgewerbe, in der Hauswirtschaft und in der Verwaltung.14 In der unmittelbaren Nachkriegszeit vermittelten die Arbeitsämter im Ruhrgebiet Frauen auch in die Montanbetriebe,15 allerdings nur so lange, bis wieder ausreichend Männer für diese Arbeiten zur Verfügung standen.
Die meisten Flüchtlinge wurden zunächst in den ländlichen Gegenden in Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Niedersachsen und Bayern untergebracht. Die in „Aufbau West“ vorgestellten Lebensgeschichten verdeutlichen, wie bereits unmittelbar nach der Ankunft im Westen alle Familienmitglieder zur Versorgung beitragen mussten. Viele Frauen und Mädchen arbeiteten sofort aushilfsweise in der Landwirtschaft, auch die kleineren Kinder, die häufig nach der Schule zum Auflesen von Kartoffeln oder Getreide aufs Feld geschickt wurden. Erleichtert wurde das Einleben in der Fremde, wenn es gelang, eine Stelle im alten Beruf zu finden. So berichtet Frau Netzer: „Auch da im Lager, da hat meine Mutter sofort wieder gearbeitet, die war sofort wieder in Barkelsby auf einem Gut.“16 Sie hatte bereits in Pommern als Köchin gearbeitet und fand auch im Westen direkt wieder eine Anstellung.
Weniger sicher waren die Arbeitsplätze in der Industrie, denn die Rückkehr der Männer aus der Kriegsgefangenschaft veränderte die Lage auf dem Arbeitsmarkt grundlegend. Für die Vermittlungstätigkeit der Arbeitsämter hieß das: „Es kann darüber hinaus je nach Lage des Bezirks auch notwendig werden, Arbeitsplätze, die kriegsbedingt durch Frauen besetzt worden sind, für aus dem Wehrdienst zurückkommende männliche Arbeitskräfte, insbesondere für Kriegsversehrte, freizumachen.“17 Dass die Konkurrenz um die Arbeitsplätze härter wurde, traf vor allem die alleinstehenden Frauen, die auf Lohnerwerb angewiesen waren.18 Waren sie außerdem Flüchtlinge oder Vertriebene, fehlte ihnen zudem das soziale Netz aus Verwandten, Freunden und Nachbarn, das in Krisensituationen Unterstützung geboten hätte.19 Für sie Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig das große Arbeitskräftepotential der Frauen zu nutzen, ließ zumindest einige Kommunen neue Wege gehen.
Die Wirtschaftspolitik der Stadt Gelsenkirchen beispielsweise zielte bereits Ende der 1940er Jahre darauf ab, neue Industrien wie die Bekleidungsindustrie anzusiedeln. Damit sollte einerseits die monoindustrielle Struktur aufgebrochen und eine größere Krisensicherheit geschaffen werden, andererseits ein Arbeitsplatzangebot für Frauen entstehen.20 Beschäftigt wurden sowohl einheimische Frauen als auch die Töchter der häufig in den Flüchtlingslagern angeworbenen Neubergleute. Frau Neumann, die mit ihrer Familie nach der Flucht bei Verwandten in Gelsenkirchen untergekommen war, fand ebenfalls Arbeit in einem Bekleidungsbetrieb. Generell entwickelte sich die aufstrebende Konsumgüterindustrie mit ihrem großen Bedarf an un- und angelernten Arbeitskräften zu einem großen Arbeitsmarkt für Frauen. Allerdings ist in den folgenden Jahrzehnten ein Rückgang der Einheimischen aus den unqualifizierten Positionen erkennbar und bis 1971 eine deutliche Überrepräsentation von vertriebenen Frauen zu verzeichnen.21

Berufswahl
Bei Frau Spaleck, Jahrgang 1918, stand die Berufswahl bereits vor dem Krieg fest. Da sie in der väterlichen Tuchfabrik mitarbeiten sollte, absolvierte sie eine kaufmännische Lehre und besuchte anschließend die Webschule in Greiz / Thüringen. Nach der Flucht in den Westen 1949 baute die Familie das Unternehmen in Bocholt neu auf. Frau Spaleck organisierte gleichzeitig den Neuanfang der Maschinenfabrik ihres Ehemanns, dessen Betrieb ebenfalls von Thüringen nach Bocholt übergesiedelt war.
Frau Koch-Thalmann erzählt, dass sie ihren Vater, der in Breslau ein eigenes Geschäftslokal mit Schneiderei betrieben hatte, beim Neuanfang in Siegen unterstützen musste: „Und dann kam die Währungsreform und da hat er sich also selbständig gemacht und es war gar nicht anders möglich, als dass ich dann das Schneiderhandwerk erlernte. Da wurde gar nicht lange gefackelt.“22 Sie ging bei ihrem Vater als Herrenschneiderin in die Lehre, was damals für Mädchen eher untypisch war. Gearbeitet wurde in der eigenen Wohnung, Werkstatträume konnten sie sich nicht leisten. Sein Handwerkszeug hatte der Vater bei der Vertreibung mit eingepackt, eine Nähmaschine wurde durch den Lastenausgleich finanziert. Erst Mitte der 1960er Jahre konnte Frau Koch-Thalmann einen Beruf ausüben, der eher ihren Wunschvorstellungen entsprach. Sie arbeitete fortan als Gemeindepädagogin.
Auch Frau Scheffauer unterstützte den Neuaufbau des Familienbetriebs im Westen. Ursprünglich wollte sie auf die Hauswirtschaftsschule gehen, erlernte aber nach der Umsiedlung nach Aalen die Knopfmalerei und leitete in der familieneigenen Knopffabrik die Malereiabteilung.
Frau Schinkel bewarb sich 1946 bei einem Lehrerausbildungskurs in Schwerin. In der sowjetischen Besatzungszone waren alle Lehrer, die in Verbindung mit der NSDAP standen, aus dem Schuldienst entlassen worden. Für den Wiederaufbau des Schulsystems wurden deshalb dringend neue, unbelastete Lehrkräfte gesucht und in relativ kurzer Zeit ausgebildet. Das Kultur- und Volksbildungsamt warb mit Industriearbeiterverpflegungskarten für die Ausbildung. In einer Zeit, in der alle hungerten, war allein das ein attraktives Angebot. Dazu kam die Aussicht auf eine Wohnung, in der Frau Schinkel auch ihre Mutter und die beiden jüngeren Geschwister unterbringen konnte. Rückblickend erzählt sie: „Aber Lehrerin werden? Wenn man heute so hört, dass jeder seinen Traumberuf haben will –. Sicher. Man kann das ja verstehen. Aber manchmal muss man Kompromisse machen. Ich wollte nicht Lehrerin werden. Dass ich es dann doch geworden bin, das hat die Zeit vorgeschrieben.“23
Die Glasmalerin Frau Wendler erlernte den Beruf ihres Vaters, da dies die einzige Möglichkeit war, nach Kriegsende in der Tschechoslowakei das Auskommen zu sichern. An dem Beruf fand sie dann aber so viel Gefallen, dass sie nach der Umsiedlung in den Westen ihre Meisterprüfung ablegte und als Lehrerin an der Glasfachschule in Rheinbach arbeitete.
Um beruflich Fuß fassen zu können, waren persönliche Beziehungen häufig hilfreich. Doch gerade solche Verbindungen fehlten den zugewanderten Frauen, was sie auf dem Arbeitsmarkt häufig benachteiligte.24 Umgekehrt entwickelten sich durch die Erwerbstätigkeit neue Beziehungen, die vor allem von der nächsten Generation genutzt werden konnten, wie das Beispiel von Frau Netzer zeigt: „Meine Mutter hat sofort gearbeitet hier, mein Vater hat auch gesehen, dass er hier was bekam. Und ich war denn sofort in der Lehre beim Rechtsanwalt und dann ging es uns auch nicht schlecht. Das war ein großer Bauunternehmer in Witten [...] und da ist sie im Haushalt gewesen. Und durch diesen ganzen Bekanntenkreis wieder, [...] das war schon eine ziemlich bekannte Familie in Witten, dadurch habe ich auch meine Stelle beim Rechtsanwalt bekommen. Das war dann auch wieder so unter der Hand, so Fürsprache. Denn das war ja auch sehr schwer, da überhaupt eine Stelle zu bekommen.“25 Ihre 1953 begonnene Ausbildung als Rechtsanwaltsgehilfin bezeichnet Frau Netzer mit Blick auf ihre Freundinnen, teilweise ebenfalls Flüchtlingskinder, als ungewöhnlich. Die meisten hatten Stellen in der Hauswirtschaft angenommen. Dieses Berufsfeld spielte in der Vermittlungstätigkeit der Arbeitsämter eine große Rolle, insbesondere bei den Frauen aus Flüchtlings- und Vertriebenenfamilien.26 Auch Frau Neumann berichtet, dass ihr Ende der 1940er Jahre in Gelsenkirchen nur Hauswirtschaftsstellen angeboten wurden. Zwar bekam sie dann eine Lehrstelle als Friseurin zugesprochen, sollte aber vor Antritt der Lehre tatsächlich erst ein Jahr im Haushalt des Friseurs arbeiten. Lüttingers Studie über die Lage der vertriebenen Frauen zeigt, dass vor allem die Jahrgänge 1930–1939 und die älteren Jahrgänge 1900–1909 in solche Stellen vermittelt wurden. So nahmen 1950 mehr als ein Viertel der ins Berufsleben eintretenden vertriebenen Frauen Hauswirtschaftsstellen an.27 Allerdings ist in den 1960er Jahren diese Zahl rückläufig, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass diese Form der Dienstleistungen im privaten Bereich generell zurückging.

Frauenbilder
Die Lebensgeschichten der für „Aufbau West“ interviewten Frauen passen ganz und gar nicht zum Bild eines Rückzugs in Haushalt und Familie. Sie bestätigen eher den Trend, der sich in den Untersuchungen der letzten Jahre zur Situation der Frauen in der Nachkriegszeit und in den 1950er Jahren abzeichnet: Eine Erwerbstätigkeit wurde für viele Frauen zur Regel – und zwar nicht nur für alleinstehende und zugewanderte Frauen. In fast allen Haushalten musste nach dem Krieg ein privater Wiederaufbau betrieben, im Krieg zerstörte Güter wie Kleidung und Hausrat neu beschafft werden.28 Dazu reichte der Verdienst des Ehemanns allein häufig nicht aus. Der Bericht der Bundesregierung über die Situation der Frau in Beruf, Familie und Gesellschaft von 1966 bestätigt das: „Der rasche Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft nach dem Krieg und die hohen Wachstumsraten des Bruttosozialprodukts wären ohne die absolute und relativ steigende Beschäftigung von Frauen in diesem Umfang nicht möglich gewesen.“29 Tatsächlich stieg der Anteil der erwerbstätigen Frauen zwischen 1950 und 1962 um 70 %.30
Im öffentlichen Bewusstsein schlug sich diese Entwicklung gleichwohl kaum nieder.31 Es widersprach dem konservativen Frauenbild der Zeit genauso wie der Familienpolitik der Ära Adenauer, die ein anderes Leitbild propagierte: das der Vollfamilie mit erwerbstätigem Ehemann und der Ehefrau und Mutter, die als Hausfrau die Familie versorgte.32 Dieses Leitbild war für viele Frauen auch durchaus attraktiv: Nach den Erfahrungen der durch die Kriegsfolgen bedingten Männerlosigkeit und der alleinigen Verantwortung für Kinder und Angehörige erschien es ihnen als Überwindung des Kriegsendes und als „Signatur des Friedens“.33 Dass Frauenerwerbsarbeit im öffentlichen Bewusstsein jedoch zur Ausnahmesituation deklariert wurde, widersprach der tatsächlichen Entwicklung: Die Frauenarbeit in der Nachkriegszeit stand in der Kontinuität einer steigenden Frauenerwerbstätigkeit seit den dreißiger Jahren, die auch in der Bundesrepublik weiter anhielt.34 Allerdings hat sich an zentralen Grundproblemen der Frauenerwerbsarbeit in den 1950er Jahren nicht viel geändert: Es gab kaum Fortschritte in den Anstellungsbedingungen und Aufstiegsmöglichkeiten und vor allem die Frage der gleichen Entlohnung für Frauen und Männer blieb eines der Hauptthemen in Tarifverhandlungen bis heute. Frau Neumann und ihre Kolleginnen in der Gelsenkirchener Bekleidungsindustrie setzten sich als Betriebsrätinnen schon damals engagiert damit auseinander.
Für sie und die anderen in „Aufbau West“ vorgestellten Frauen war die Berufstätigkeit bis zur Rente selbstverständlich. Selbst Frau Tetzlaff erzählt über die erste Zeit in Dortmund nach den Erfahrungen von zehn Jahren Zwangsarbeit: „Ich habe es versucht, ich wollte arbeiten. Er hat gleich gesagt, ich brauche hier nicht mehr arbeiten. Aber ich war es gewohnt, ich muss Beschäftigung haben. Ich habe hier in der Kleiderfabrik angefangen. Das hat mir so Spaß gemacht. Aber weil das alles elektrisch mit den Maschinen ging, da kam ich nicht klar. Und da kriegte ich Kreuzschmerzen durch die Anstrengung. Da habe ich es drangegeben.“35 Frau Koch-Thalmann meint: „Naja, das hing ja damit zusammen, weil wir keinen Besitz mehr hatten. Also es war einfach von Anfang an, nach der Schule gab es gar keine andere Entscheidung als, ja, Lebensunterhalt zu verdienen.“ Und als es materiell besser ging: „Naja, da bin ich ganz ehrlich, wenn man mal soweit ist, dass man auf einem bestimmten Level, sagen wir mal BAT IV b ist, dann denkt man, jetzt könntest du das sparen, da ging das ja mit dem Autokaufen los und ja, dann ist man auch Single mit Leib und Seele und ist nicht gebunden und hat also einen Job und ist zufrieden damit.“36 Für sie bedeutete die Berufstätigkeit auch Unabhängigkeit. Frau Netzer betont: „Also für mich war das wirklich ein Ziel, ich wollte immer berufstätig sein, ich wollte immer was werden. Ich wollte wirklich einen richtigen Beruf haben, das war für mich immer wichtig.“37
Es bleibt zu untersuchen, ob diese Einstellung typisch ist für Frauen aus Flüchtlings- und Vertriebenenfamilien. Haben die Erfahrungen vom plötzlichen Verlust der ökonomischen und sozialen Bindungen und der Zwang zum völligen Neuanfang hier ein größeres Bewusstsein für die Notwendigkeit zur ökonomischen Eigenständigkeit geschaffen als bei einheimischen Frauen? Und schließlich: Wie haben sich diese Erfahrungen auf die Generation der Töchter übertragen? Auch im Hinblick auf diese übergenerationellen Fragen erscheint eine ausführlichere Erforschung der sozialen und beruflichen Integration von vertriebenen Frauen und Mädchen vom Kriegsende bis heute lohnenswert.
Biografien
Margret Riedl
Brunhild Schinkel
Dorothea Koch-Thalmann
Erika Netzer
Elsa Tetzlaff
Marianne Jedamczik
Lotte Neumann
Gertrud Jung
Fußnoten
- Vgl. u.a. Domansky, Elisabeth und Jutta de Jong: Der lange Schatten des Krieges. Deutsche Lebens-Geschichten nach 1945, Münster 2000, S. 230.
- Vgl. u.a. Mooser, Josef: Arbeiter, Angestellte und Frauen in der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“. Thesen, in: Schildt, Axel und Arnold Sywottek (Hg.): Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre, Bonn 1993, S. 364.
- Eine ausführlichere Analyse zur Lage der zugewanderten Frauen in Westdeutschland findet sich bei Paul Lüttinger: Integration der Vertriebenen. Eine empirische Analyse, Frankfurt a. M./New York 1989, S. 129–165.
- Vgl. u.a. Plato, Alexander von: Fremde Heimat. Zur Integration von Flüchtlingen und Einheimischen in die Neue Zeit, in: Niethammer, Lutz und Alexander von Plato (Hg.): „Wir kriegen jetzt andere Zeiten“. Auf der Suche nach der Erfahrung des Volkes in nachfaschistischen Ländern. Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930 bis 1960, Bd. 3, Bonn/Berlin 1985, S. 172–219; Domansky, Elisabeth und Jutta de Jong: Der lange Schatten des Krieges. Deutsche Lebens-Geschichten nach 1945, Münster 2000; Meyer, Sibylle und Eva Schulze: Von Liebe sprach damals keiner. Familienalltag in der Nachkriegszeit, München 1985; Dörr, Margarete: „Wer die Zeit nicht miterlebt hat...“ Frauenerfahrungen im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach, 3 Bde., Frankfurt a. M./New York 1998.
- Im Rahmen des Ausstellungsprojekts wurden insgesamt acht Frauen anhand eines Interviewleitfadens zu ihrem Lebensweg – Flucht und Vertreibung, Ankunft und Einleben im Westen, beruflicher Werdegang – befragt. Zusätzlich lagen bei zwei Frauen bereits publizierte Lebensgeschichten vor.
- Siehe dazu die ausführliche Sammlung von Erfahrungsberichten in: Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, bearbeitet von Theodor Schieder, hg. v. Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 5 Bde., (Bonn) 1954–1961, Reprint in neun Bänden, München 1984.
- Interview 21.06.2004, Archiv Westfälisches Industriemuseum.
- Interview 20.07.2004, Archiv Westfälisches Industriemuseum.
- Zu diesem Komplex ausführlich: Benz, Wolfgang: Der Generalplan Ost. Zur Germanisierungspolitik des NS-Regimes in den besetzten Ostgebieten 1939–1945, in: Benz, Wolfgang (Hg.): Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten: Ursachen, Ereignisse, Folgen, Frankfurt/M. 1985, S. 39–48; Beer, Mathias: Die Vertreibung der Deutschen. Ursachen, Ablauf, Folgen, in: Flucht und Vertreibung. Europa zwischen 1939 und 1945, mit einer Einleitung von Arno Surminski, Hamburg 2004, bes. S. 26–32.
- Interview 10.11.2004, Archiv Westfälisches Industriemuseum.
- Interview 28.06.2004, Archiv Westfälisches Industriemuseum.
- Schubert, Doris: Frauen in der deutschen Nachkriegszeit, Bd. 1: Frauenarbeit 1945–1949. Quellen und Studien, hrsg. v. Annette Kuhn, Düsseldorf 1984, S. 15.
- Dörr, Margarete: „Wer die Zeit nicht miterlebt hat...“ Frauenerfahrungen im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach, Bd. 3, Frankfurt a. M./New York 1998, S. 84.
- Vgl. Ruhl, Klaus-Jörg: Verordnete Unterordnung. Berufstätige Frauen zwischen Wirtschaftswachstum und konservativer Ideologie der Nachkriegszeit 1945–1963, München 1994, S. 48–51.
- Vgl. u.a. Landesarchiv NRW, Staatsarchiv Münster, Arbeitsämter Nr. 849: Arbeitsamt Dortmund: Bericht an das Landesarbeitsamt über Probleme der Frauennachtarbeit in Dortmunder Hüttenbetrieben 1949.
- Interview 28.06.2004, Archiv Westfälisches Industriemuseum.
- Landesarchiv NRW, Staatsarchiv Münster, Arbeitsämter Nr. 1620, Rundschreiben des Arbeitsamtes Iserlohn vom 3.11.1945, S. 3.
- Zur Situation dieser Frauen ausführlich: Meyer, Sibylle und Eva Schulze: Wie wir das alles geschafft haben. Alleinstehende Frauen berichten über ihr Leben nach 1945, Berlin 1984.
- Zu den unterschiedlichen „Startbedingungen“ von Frauen in der Nachkriegszeit ausführlich: Dörr, Margarete: „Wer die Zeit nicht miterlebt hat...“ Frauenerfahrungen im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach, Bd. 3, Frankfurt a. M./New York 1998, S. 83–86.
- Siehe ausführlich zu diesem Komplex den Beitrag von Brigitte Schneider und Arnold Lassotta in diesem Band sowie das Buch von Birgit Beese und Brigitte Schneider: Arbeit an der Mode. Zur Geschichte der Bekleidungsindustrie im Ruhrgebiet, Essen 2001.
- Vgl. Lüttinger, Paul: Integration der Vertriebenen. Eine empirische Analyse, Frankfurt a. M./New York 1989, S. 159 ff.
- Interview 21.06.2004, Archiv Westfälisches Industriemuseum.
- Schinkel, Eckhard (Hg.): Harte, schöne Zeit. Brunhild Doliwa: Neulehrerin in Mecklenburg 1944-1950, 2. Aufl. Dortmund 2001, S. 48.
- Vgl. Lüttinger, Paul: Integration der Vertriebenen. Eine empirische Analyse, Frankfurt a. M./New York 1989, S. 136.
- Interview 28.06.2004, Archiv Westfälisches Industriemuseum.
- Vgl. Landesarchiv NRW, Staatsarchiv Münster, Arbeitsämter Nr. 764: Arbeitsamt Dortmund: Protokoll des Fachausschusses für Frauenfragen vom 22.10.1949; Arbeitsämter Nr. 847: Arbeitsamt Dortmund: Vermittlung von Hausangestellten 1949–1959.
- Vgl. Lüttinger, Paul: Integration der Vertriebenen. Eine empirische Analyse, Frankfurt a. M./New York 1989, S. 150.
- Vgl. Wildt, Michael: Privater Konsum in Westdeutschland in den 50er Jahren, in: Schildt, Axel und Arnold Sywottek (Hg.): Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre, Bonn 1993, S. 280.
- Verhandlungen des Deutschen Bundestages V. Wahlperiode. Anlage zu den stenographischen Berichten, Nr. 909, zitiert nach: Ruhl, Klaus-Jörg: Verordnete Unterordnung. Berufstätige Frauen zwischen Wirtschaftswachstum und konservativer Ideologie der Nachkriegszeit 1945–1963, München 1994, S. 11.
- Ruhl, Klaus-Jörg: Verordnete Unterordnung. Berufstätige Frauen zwischen Wirtschaftswachstum und konservativer Ideologie der Nachkriegszeit 1945–1963, München 1994, S. 11.
- Vgl. Kuhn, Annette: Die vergessene Frauenarbeit in der deutschen Nachkriegszeit, in: Freier, Anna-Elisabeth und Annette Kuhn (Hg.): Frauen in der Geschichte V. „Das Schicksal Deutschlands liegt in der Hand seiner Frauen“ – Frauen in der deutschen Nachkriegsgeschichte, Düsseldorf 1984, S. 172.
- Dazu ausführlich u.a.: Langer, Ingrid: In letzter Konsequenz... Uranbergwerk! Die Gleichberechtigung in Grundgesetz und Bürgerlichem Gesetzbuch, in: Perlonzeit. Wie die Frauen ihr Wirtschaftswunder erlebten, Berlin 1985, S. 72–81.
- Pointke, Johanna: Frauenbilder der Nachkriegszeit, in: „Wir haben uns so durchgeschlagen...“ Frauen im Bielefelder Nachkriegsalltag 1945–1950, Bielefeld 1992, S. 168.
- Dazu u.a. Wikander, Ulla: Von der Magd zur Angestellten. Macht, Geschlecht und Arbeitsteilung 1789–1950, Frankfurt/M. 1998.
- Interview 10.11.2004, Archiv Westfälisches Industriemuseum.
- Interview 21.06.2004, Archiv Westfälisches Industriemuseum.
- Interview 28.06.2004, Archiv Westfälisches Industriemuseum.