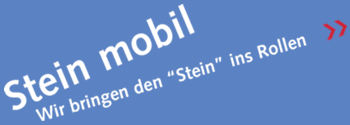Baustein 3 schlägt den Bogen aus der Zeit des Freiherrn vom Stein in die Gegenwart, zur heutigen Gemeindeordnung in Nordrhein-Westfalen. Unter besonderer Berücksichtigung der Bürgerbeteiligungsrechte von Jugendlichen werden hier die aktuellen Möglichkeiten zur Partizipation der Bürger/innen an der Kommunalpolitik untersucht.
Mit Hilfe eines Textes über die "Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung" (» M 3.01), einer Zusammenstellung über die Aufgaben der Gemeinden (» M 3.02) und/oder Schemata zur Gemeindeordnung in NRW (» M 3.03) und zu Entscheidungs- prozessen in der Kommune (» M 3.04) werden die Schüler/innen in die Grundlagen der aktuellen Kommunalpolitik eingeführt. Dabei sollten auch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Stein’schen Städteordnung herausgearbeitet werden, z.B. durch die Auseinandersetzung mit den heutigen Definitionen von Bürger/innen und Einwohner/innen und deren Rechten (» M 3.05).
Danach werden die Ergebnisse der Recherchen der Schüler/innen zur Hausaufgabe aus » Baustein 2 (» M 3.13, » M 3.14) zusammengetragen. So entsteht ein erstes Bild von den aktuellen Machtverhältnissen in Rat und Verwaltung und den Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger/innen und insbesondere für Jugendliche vor Ort.
In der nun folgenden Vorstellung und Beurteilung der gesetzlich vorgesehenen Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten in nordrhein-westfälischen Kommunen werden die bisherigen Punkte noch einmal systematisch zusammengefasst (» M 3.07). In Gruppenarbeit werden diese formalen und freien Möglichkeiten zunächst erforscht und dann in Kurzvorträgen vorgestellt: Wahlen (» M 3.08), Einwohneranträge (» M 3.09), Bürgerbegehren/ Bürgerentscheid (» M 3.10), Bürgerbeteiligung bei der Stadtplanung (» M 3.11), sonstige formale Möglichkeiten
(» M 3.12) und besondere Beteiligungsmodelle für Jugendliche
(» M 3.13) genauso wie freie Möglichkeiten (» M 3.14).
Zur Vertiefung wird die Frage nach den Gründen für die geringe Beteiligung Jugendlicher an der Kommunalpolitik gestellt. Wegen der wahrscheinlichen Skepsis der Schüler/innen gegenüber diesem "trockenen und langweiligen" Thema wird die Methode des "Kopfstandes" vorgeschlagen (» M 3.15). Im Perspektivenwechsel äußern sich die Schüler/innen in einem an der Tafel oder auf dem Overheadprojektor festgehaltenen Brainstorming zur Frage: "Was können die Gemeindepolitiker/innen tun, damit sich absolut kein Jugendlicher mehr an den Aufgaben und Entscheidungen der Gemeinde beteiligt?" Durch die Auseinandersetzung mit den Gedanken und Ideen der konträren Problemstellung werden eingefahrene Sichtweisen aufgelöst und die Einstellungen anderer Beteiligter systematisch in die Ideensuche miteinbezogen. In der folgenden Phase, in der zu den genannten Ideen Gegenlösungen gesucht werden, erarbeiten die Schüler/innen Aspekte zur eigentlichen Problemstellung, der Frage nach möglichst optimalen Bedingungen für die Mitarbeit von Jugendlichen an der Gemeindepolitik.
Für den Abschluss dieses Bausteins wurde ein Entscheidungs- spiel vorbereitet, in dem in einem Rollenspiel die Vor- und Nachteile verschiedener Jugendbeteiligungsformen argumentativ ausgetauscht werden können. Das Szenario sieht vor, dass ein Expertengremium im Auftrag des Stadtrates einen Vorschlag zur Einrichtung eines Jugendparlamentes vorbereitet. In Gruppenarbeit werden die Rollen und ihre Argumente vorbereitet und jeweils ein/e Schüler/in als Vertreter/in der jeweiligen Gruppe im Gremium bestimmt.
Als Rollen sind vorgesehen:
- Jugendvertreter/in SV (contra)
- Jugendvertreter/in Partei (pro)
- Politikwissenschaftler/in (neutral)
- Vorsitzende/r Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie des Gemeinderates (contra)
- Leiter/in Jugendamt (pro)
Eine genaue Einführung in das Entscheidungsspiel (» Info 3.07), Hinweise zum Verlauf (» M 3.16, » M 3.17) und die Rollenkarten samt Hintergrundinformationen (» M 3.18, » M 3.19, » M 3.20,
» M 3.21, » M 3.22 » M 3.23, » Info 3.08) sind dafür vorbereitet.
Nach der Auswertung des Entscheidungsspiels kann direkt zur eigenen Jugendbefragung zum Thema "Jugend und Gemeindepolitik in ....." übergeleitet werden (siehe » Baustein 4).
![]()
![]()
» Info 3.01
Gesetzliche Grundlagen
» Info 3.02
Gemeindeordnung NRW
» Info 3.03
Hoheitsrechte der Gemeinden in NRW
» Info 3.04
Lösungsblatt zur Hausaufgabe aus Baustein 2
» Info 3.05
Bürgerbeteiligungsrechte im Überblick
» Info 3.06
Jugendparlamente und Jugendforen in Westfalen
» Info 3.07
Einführung in das Entscheidungsspiel "Jugend redet mit"
» Info 3.08
Rollenkarte Diskussionsleitung/ Moderation
» M 3.01
Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung in NRW
» M 3.02
Aufgaben der Gemeindepolitik
» M 3.03
Gemeindeordnung NRW (Schema)
» M 3.04
Entscheidungsprozesse in Gemeinden (NRW)
» M 3.05
"Bürger" und "Einwohner" heute
» M 3.06
Gemeindeordnung NRW (Textauszug)
» M 3.07
Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten in der Gemeinde
» M 3.08
Gruppe 1: Wahl
» M 3.09
Gruppe 2: Einwohnerantrag
» M 3.10
Gruppe 3: Bürgerbegehren/ Bürgerentscheid
» M 3.11
Gruppe 4: Bürgerbeteiligung Stadtplanung
» M 3.12
Gruppe 5: Sonstige Möglichkeiten/ Aspekte formaler Beteiligung
» M 3.13
Gruppe 6: Besondere Beteiligungs-Modelle für (Kinder und) Jugendliche
» M 3.14
Gruppe 7: Freie Beteiligungsmöglichkeiten
» M 3.15
"Kopfstand" zur Beteiligung Jugendlicher an der Gemeindepolitik
» M 3.16
Verlauf des Entscheidungsspiels (Hinweise)
» M 3.17
Beschreibung der Problemsituation
» M 3.18
Rollenkarte 1: Jugendvertreter – SV (contra)
» M 3.19
Rollenkarte 2: Jugendvertreter – Partei (pro)
» M 3.20
Rollenkarte 3: Vorsitzende/r des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie des Gemeinderates (contra)
» M 3.21
Rollenkarte 4: Politikwissenschaftler/in (neutral)
» M 3.22
Rollenkarte 5: Leiter/in des Jugendamtes (pro)
» M 3.23
Beobachtungsbogen