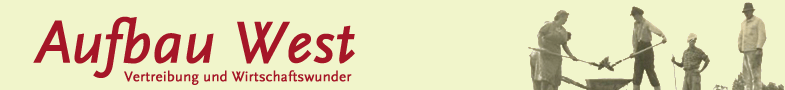Beginn des Inhalts/Link zum Seitenanfang| Link zur Seitennavigation|
Aufbau West. Der Januskopf der nordrhein-westfälischen Nachkriegswirtschaft
- Das Dilemma
- Die Ankurbelung
- Nach der Währungsreform
- Nordrhein-Westfalen und das ‚Wirtschaftswunder‘
- Resümee
- Fußnoten
Das Dilemma
Anfang der 1950er Jahre – der ‚Aufbau West‘ war noch in vollem Gange – stritten sich die Bundesregierung und das Land Nordrhein-Westfalen öffentlich über die Wirtschaftskraft des Landes. Der Bonner Finanzminister wollte Nordrhein-Wetsfalen gehörig zum Finanzausgleich zwischen den Bundesländern heranziehen und so pries er vor allem seine Lokomotivfunktion für den westdeutschen Wiederaufbau. Aus dieser Perspektive stach Nordrhein-Westfalen als das „wirtschaftskräftigste Land mit der relativ günstigsten wirtschaftlichen Entwicklung“ selbst jene Bundesländer aus, die ebenfalls im „überdurchschnittlichen Maße“ am wirtschaftlichen Aufschwung teilnahmen. Langfristig drohten die Länder im östlichen Teil der Bundesrepublik aus Bonner Sicht sogar „in progressivem Tempo“ zugunsten des kapitalreichen Nordrhein-Westfalens zu „veröden“.1
Als wollte sie eine Legendenbildung im Keim ersticken, trat dem die Landesregierung entschieden entgegen. Das Essener Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung, das für die Landesregierung gutachtete,2 kam zu dem für die Öffentlichkeit überraschenden Ergebnis, dass Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum übrigen Bundesgebiet an industrieller Dynamik verloren hatte. Das höchste Pro-Kopf-Einkommen, die niedrigste Arbeitslosenquote und die stärkste Steuerkraft im Bundesgebiet konnten auf Dauer nicht verbergen, dass Nordrhein-Westfalen seine augenfällige wirtschaftliche Potenz politischen Sonderkonjunkturen verdankte, die noch dazu auf lange Sicht der nötigen Umstrukturierung der Wirtschaft im Weg standen. Drei Faktoren waren für diesen latenten Bedeutungsverlust der Region verantwortlich:
- Nordrhein-Westfalen war ein ‚altes‘ Industrieland und warf vor hohem Entwicklungsniveau nur noch einen kleineren Wachstumsschatten als die (südlichen) Bundesländer, die am Beginn ihrer (nach)industriellen Entwicklung standen.
- Das Land an Rhein und Ruhr zählte nicht zu den typischen Standorten der ‚Neuen Industrien‘, die, wie der Maschinenbau oder die Elektrotechnik, ihre Dynamik der Verwissenschaftlichung der Produktion verdankten.
- Investitions- und Konsumgüter, die über die Wiederaufbauphase hinaus nachgefragt wurden, waren in Nordrhein-Westfalen weniger stark vertreten als in den übrigen Bundesländern.
In der Öffentlichkeit stießen solche Hinweise zumeist auf Unverständnis und Kritik, standen sie doch im krassen Gegensatz zur nach 1945 gewachsenen und (bis 1957) noch wachsenden Bedeutung des rheinisch-westfälischen Industriebezirks für den westdeutschen und westeuropäischen Wiederaufbau und das strategische Wirtschaftspotenzial der westlichen Welt. Auf den ersten Blick hatte Nordrhein-Westfalen ja auch Glück gehabt, dass seine alte Industrie erneut, wie schon nach dem Ersten Weltkrieg, heißbegehrte ‚Wiederaufbaugüter’ im Angebot hatte, allen voran Kohle und Stahl. Schon auf mittlere Frist lag aber gerade darin das Problem. Erneut blieb dem rheinisch-westfälischen Raum die Chance verwehrt, seine Wirtschaftsstruktur zu modernisieren. Im Gegenteil, seine Problemindustrien nahmen noch an Gewicht zu, während die südlichen Bundesländer frei von dieser Last in eine bessere nachindustrielle Zukunft aufbrechen konnten.
Die Ankurbelung
Die Wiederankurbelung der westdeutschen Industrie reduzierte sich in den ersten Nachkriegsjahren im Wesentlichen auf die Förderung und Verteilung von Kohle. Damit nahm das rheinisch-westfälische Industrierevier für die wirtschaftliche – und weit darüber hinaus auch für die politische und soziale – Entwicklung der Westzonen eine Schlüsselrolle ein. Die Kohle beherrschte die Wirtschaftsplanung und -lenkung der ‚Vorwährungszeit‘ so total, dass Alliierte wie Deutsche gleichermaßen in der Lenkung der Kohlenwirtschaft den Schlüssel zum Wiederaufbau in ganz Westeuropa sahen.
Der Kohlebergbau stand deshalb im Zentrum der Ankurbelungsmaßnahmen, die auf Drängen der amerikanischen Militärregierung seit Beginn des Jahres 1947 ergriffen wurden. Neben den Zechen betraf das Programm vor allem das Verkehrswesen und – in bescheidenerem Umfang – die Stahl- und Eisenindustrie. Es legte damit seinen regionalen Schwerpunkt auf Nordrhein-Westfalen, das zum wirtschaftlichen Angelpunkt einer neuen Stabilisierungsstrategie für Westeuropa wurde. Hatten die Vereinigten Staaten bis dahin angenommen, Westeuropa könne auf Kosten des Ruhrgebiets wiederaufgebaut und materiell gefestigt werden, so hatte sich im Laufe des Jahres 1946 die Erkenntnis durchgesetzt, dass dies nur mit Hilfe des noch immer bedeutenden Potenzials des rheinisch-westfälischen Industriebezirks gelingen könne.
Der neue Kurs der Militärregierung schlug sich zuerst im Bergbau nieder. Die Einführung eines Anspornsystems für die Bergarbeiter (‚Punktsystem‘) forcierte den Wiederaufbau der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrie, der mit einer kurzen Unterbrechung nach der Währungsreform bis zum Ende der Koreakrise (1952) anhielt. Das Bergarbeiter-Punktsystem reduzierte die Zahl der Feierschichten spürbar und machte den Bergbau für revierfremde Arbeiter attraktiv. Die Zusatzrationen an Nahrungs- und Genussmittel wurden zunächst ausschließlich aus deutschen Beständen abgezweigt, so dass sich die Lage des ‚Normalverbrauchers‘ gerade im Ruhrgebiet weiter verschlechterte. Immerhin gelang es, die Belegschaftsstärken an der Ruhr schon im März 1947 wieder auf den Vorkriegsstand zu bringen, während die Produktivität erst wieder Mitte der 1950er Jahre soweit war. Die materiellen Anreize trugen wesentlich dazu bei, die lähmende Stagnation des Jahres 1946 in der Kohlenförderung zu überwinden. Dennoch erhielten revierferne Räume Anfang 1947 kaum mehr als die Hälfte der zugesagten Kohle-Lieferungen. Vielmehr wuchsen die Halden an der Ruhr von Dezember 1946 bis Februar 1947 um mehr als das Dreifache. Diese Entwicklung signalisierte eine Transportkrise großen Ausmaßes, die durch die extreme Kälte im Winter 1946/47 noch verschärft wurde. Auf diese beiden Engpässe – Kohleförderung und Verkehrssystem – konzentrierte die Wirtschaftsverwaltung 1947 alle Ressourcen der bizonalen Wirtschaft. Die Lösung des Transportproblems war neben der Ankurbelung der Kohleförderung zweifellos einer der wenigen, gleichwohl aber wichtigen Erfolge der Wirtschaftsplanung der Nachkriegszeit. Mit der Normalisierung der Verkehrslage im Sommer 1947 wurde es zum ersten Mal möglich, das Auslieferungssoll für Industriekohle zu erfüllen, so dass sich die Kohleversorgung der westdeutschen Industrie fast schlagartig um ein Drittel verbesserte. Gleichzeitig hoben die Planer die Produktionssperre in der Eisen- und Stahlindustrie faktisch auf.
Charakter und Ansatzpunkte dieser Maßnahme machen deutlich, dass der eigentliche Kraftakt der wirtschaftlichen Ankurbelung der westdeutschen Wirtschaft an Rhein und Ruhr stattfand. Für Nordrhein-Westfalen hatte dies ganz unterschiedliche Konsequenzen. Binnen zwei Jahren war aus einer Industrie, die der Morgenthau-Plan auf die Todesliste gesetzt hatte, das Schwungrad des westdeutschen und darüber hinaus des westeuropäischen Wiederaufbaus geworden. Viele seiner Bewohner – allen voran die Bergarbeiter – genossen sogar unerhörte materielle Privilegien. Sonderzuteilungen von Speck, Kaffee, Zigaretten, Zucker und Schnaps für die Bergleute und andere zulageberechtigte Schwerstarbeiter waren zwar in der Öffentlichkeit außerhalb des Reviers und bei den nordrhein-westfälischen ‚Normalverbrauchern‘ nicht gerade gern gesehen, hoben aber den ‚Lebensstandard‘ in Nordrhein-Westfalen schon vor der Währungsreform deutlich über das allgemeine westdeutsche Niveau. Der rheinisch-westfälische Industriebezirk wurde in der unmittelbaren Nachkriegszeit geradezu zum Symbol wirtschaftlicher Kraft. Die Ankurbelung ging aber nicht mit großzügigen Neuinvestitionen in den industriellen Kapitalstock einher. Angesichts des überraschend großen Umfangs, des geringen Alters und der günstigen Zusammensetzung der aus dem Krieg in den Wiederaufbau hinübergeretteten Produktionsanlagen, war dies im allgemeinen auch nicht nötig.3 Anders im Kohlenbergbau.4 Die Anreize des Punktsystems hoben zwar seine Förderkapazität, nicht aber seine Produktivität. Die Leistungssteigerung der Jahre 1947/48 ging vielmehr weiter auf die Substanz der Zechen. Kapitalinvestitionen waren ausgeblieben, die Belegschaften zwar erweitert, ihre Qualifikation aber nicht verbessert worden. Wirtschaftlich gesehen blieb damit der Kernbereich der rheinland-westfälischen Montanindustrie ein Koloss auf tönernen Füßen.
Nach der Währungsreform
Die Währungs- und Wirtschaftsreform von 1948 setzte unter die Bevorzugung der Grundstoffindustrien einen vorläufigen Schlussstrich. Die Wirtschaftslage blieb an Rhein und Ruhr aber nach wie vor gut. Auch hier wurden der Geldschnitt und die auf ihn folgende Liberalisierung wichtiger Konsumgüter als die entscheidende Wende zum Besseren hin gedeutet. Das kurzfristige Warenangebot stieg für alle verblüffend rasch an und festigte auf lange Zeit den Mythos der Währungsreform als eigentliche Initialzündung und Beginn einer nunmehr stürmisch verlaufenden Phase des Wiederaufbaus. Die soziale Lage der Menschen an Rhein und Ruhr verlor freilich in dem Maße an Glanz, wie sich ihre Versorgungsprivilegien nach dem 20. Juni 1948 zum allgemeinen Besitzstand einer konsumorientierten Wiederaufbaugesellschaft wandelten. Dennoch lag Nordrhein-Westfalen auch nach der Währungsreform an der Spitze der wirtschaftlichen Leistungs- und Ertragsskala und am unteren Ende der Arbeitslosigkeit. Während im übrigen Bundesgebiet die Arbeitslosenzahlen rasch anstiegen und im Februar 1951 mit zwei Millionen Erwerbslosen (10 Prozent) ihren Höhepunkt erreichten, lag die Arbeitslosenquote an Rhein und Ruhr in den ersten fünf Jahren nach der ‚Währung’ um mehr als die Hälfte unter dem Bundesdurchschnitt.
Auch andere Indikatoren signalisierten relativen Wohlstand. So lag das nordrhein-westfälische Aufkommen an Besitz- und Umsatzsteuern im Rechnungsjahr 1952/53 je Kopf der Bevölkerung deutlich höher als in den übrigen Flächenstaaten. Lediglich die Stadtstaaten Hamburg und Bremen übertrafen Nordrhein-Westfalen an Steuerkraft. An Rhein und Ruhr wurden auch hohe Löhne gezahlt. Die Monatseinkommen der Industriearbeiter lagen um 10 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Entsprechend günstig entwickelten sich die Einzelhandelsumsätze. Nordrhein-Westfalen profitierte auch überproportional stark von Wohnungsbauprogrammen der Besatzungszonen und des Bundes – später auch vom sozialen Wohnungsbau. Und doch zeichnete sich schon bald nach Kriegsende ab, dass Nordrhein-Westfalens Industrie nicht zukunftsfähig war. Diejenigen Branchen, die sich im gesamten Bundesgebiet seit Kriegsende günstig entwickelt hatten, spielten hier keine große Rolle. Gliedert man die Industrie nach Wachstumsgruppen, so zeigt sich, dass die auf der ‚Schattenseite‘ der Entwicklung stehenden Industrien in Nordrhein-Westfalen ein größeres Gewicht hatten. Ihr Anteil betrug hier 71 Prozent, im übrigen Bundesgebiet 57 Prozent.5 Die Konzentration aller Kräfte des Wiederaufbaus auf ‚alte‘ Produktionsgüterindustrien, die von den Menschen an Rhein und Ruhr zunächst als ein großer Vorzug empfunden worden war, hatte diese Entwicklung noch verstärkt. Das wirtschaftliche Potenzial des Landes wurde nahezu völlig von den Bedürfnissen der ‚alten‘ Branchen absorbiert, die – wie der Kohlenbergbau – in der ersten Phase des Wiederaufbaus von entscheidender Bedeutung, langfristig gesehen aber wachstumsschwache Industrien waren.
In der Koreakrise der frühen fünfziger Jahre rückte Nordrhein-Westfalen erneut in den Brennpunkt der Wirtschaftspolitik. Der weltweit einsetzende Rüstungsboom traf die im Wiederaufbau fortschreitende Bundesrepublik auf dem falschen Fuß. Ludwig Erhard hatte seine Wiederaufbaustrategie seit der Wirtschaftsreform von 1948 ganz auf die Konsumgüterindustrie abgestellt. Angesichts knapper Ressourcen musste diese Politik zu Lasten der Grundstoffindustrie gehen. Damit leitete Erhard auch in regionaler Sicht eine Verlagerung der Schwerpunkte deutscher Wirtschaftspolitik ein. Das Industriegebiet an Rhein und Ruhr, das in der ‚Vorwährungszeit‘ zum neuralgischen Zentrum aller Wiederaufbauanstrengungen geworden war, trat für kurze Zeit in den Hintergrund des Wirtschaftsgeschehens. Investitionen im Grundstoffbereich, die im Rahmen der Bewirtschaftung durch realen Ressourcentransfer ermöglicht worden waren, wurden nun mit schwierigen Finanzproblemen belastet. Für private Investoren war das Engagement im schwerindustriellen Bereich auch aus anderen Gründen wenig attraktiv. Noch immer hing die Eigentumsfrage in der Eisen- und Stahlindustrie und im Kohlenbergbau in der Schwebe. Zudem bestanden bis in die frühen fünfziger Jahre alliierte Beschränkungen und Vorbehalte für diese Industrien. Hierin lag aber auch die Chance zur Diversifizierung der industriellen Monostruktur. Doch die zaghafte Neuorientierung wurde mit Beginn der Koreakrise jäh unterbrochen. Der schwerindustrielle Engpass wurde zum Politikum. Vor allem die Vereinigten Staaten drängten die Bundesregierung im Interesse der ‚Verteidigung der freien Welt‘, ihre Wiederaufbaustrategie zugunsten der Schwerindustrie zu korrigieren.
Zunächst schienen dem Land Nordrhein-Westfalens daraus nur Vorteile zu erwachsen. Die Stahlindustrie konnte die Fesseln des Potsdamer Abkommens abstreifen und im August 1951 auch offiziell die Stahlquote von 11,1 Millionen Tonnen überschreiten, die ihr im alliierten Industrieplan auferlegt worden war. Der Bergbau zog erneut alle Aufmerksamkeit und wichtiger noch, zahlreiche neue Subventionen auf sich. Hauptfinanzierungsquelle war die ‚Investitionshilfe der gewerblichen Wirtschaft‘, die als Reaktion auf die Engpässe und auf amerikanischen Druck insgesamt 1,2 Milliarden DM vom Konsum- und Investitionsgüterbereich in die Engpassindustrie umlenkte.6 Die Mittel kamen im Wesentlichen der Strom-, Gas- und Wasserversorgung, der Stahlindustrie und dem Kohlenbergbau zugute. Angesichts dieser Verwendungsstruktur wundert es nicht, dass allein 70 Prozent der Investitionshilfe nach Nordrhein-Westfalen flossen, während nur 34 Prozent dort auch umgesetzt wurden. Die Investitionshilfe der gewerblichen Wirtschaft und Transfers der öffentlichen Hände für die Ruhrindustrie führten für wenige Jahre zu einem subventionierten come back der Grundstoffindustrie. Die Mittel, die dafür aufgewendet wurden, standen für eine zukunftsorientierte Strukturpolitik nicht mehr zur Verfügung.
Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion) am 25. Juli 1952 schien diese eindeutige Bevorzugung der Schwerindustrie zu rechtfertigen. Aus dem Ruhrgebiet wurde ‚Europas Revier’. Der Vorteil dieser Entwicklung lag für Nordrhein-Westfalen auf der Hand. Karl Arnold, der Ministerpräsident des Landes, hatte schon Anfang 1949, nach der Verkündigung des drückenden Ruhrstatuts vorgeschlagen, „auf der wirtschaftlichen Ebene einmal vorzufühlen, welche Bedingungen erfüllt sein müßten, damit die französische Schwerindustrie sich zu einem gemeinsamen Vorgehen bereit findet, dessen Zweck es ist, die einseitigen Zwangs- und Kontrollmethoden des Ruhrstatuts in vernünftige freiwillige Zusammenarbeit umzuwandeln“.7 Noch im Oktober 1950 arbeiteten von den 123 Hochöfen, die Krieg und Demontagen überstanden hatten, nur 78. Um die Kapazität voll ausfahren zu können, fehlte es vor allem an Kokskohle. Gleichzeitig musste die Bundesrepublik nach dem Ruhrstatut vierteljährlich 6,8 Mio. Tonnen Kohle, d. h. mehr als ein Viertel ihres gesamten Steinkohleabsatzes exportieren. Die Montanunion beseitigte die meisten dieser Lasten. Es blieb aber die vertraglich festgelegte völkerrechtliche Verpflichtung, Ruhrkohle für die Energieversorgung aller Partnerstaaten gleichermaßen zur Verfügung zu stellen – eine Klausel, die vor allem auf den Krisenfall gezielt ist. Die Montanunion festigte damit die politische Sonderrolle der nordrhein-westfälischen Schwerindustrie und war dem wirtschaftlichen Strukturwandel in diesem Sektor eher hinderlich.
Nordrhein-Westfalen und das ‚Wirtschaftswunder‘
Nordrhein-Westfalens Industrie war also schon am Anfang der fünfziger Jahre vergleichsweise ungünstig zusammengesetzt. Dies bedeutet nicht, dass das Land an der Entwicklung ‚neuer‘ Industrien überhaupt nicht teilgenommen hätte. In einigen Industriezweigen wuchs die Produktion sogar stärker als im Bundesgebiet, wie zum Beispiel in der Mineralölverarbeitung, der Elektrizitätserzeugung, der Industrie der Steine und Erden, im Fahrzeugbau und in der Bauindustrie. Diese Bereiche waren schon vor und während des Krieges ausgebaut worden. Die Bauindustrie war zudem hier mit stärkeren Kriegszerstörungen konfrontiert als im übrigen Bundesgebiet und förderte deshalb auch das Wachstum der Baustofferzeugung. Alles in allem gesehen war der Anstoß, den die Wirtschaft Nordrhein-Westfalens aus dieser Richtung erfuhr, jedoch bei weitem nicht so stark wie die Antriebskräfte, die hinter dem industriellen Wachstum der übrigen Bundesländer standen. Das Defizit lag vor allem in den Investitionsgüterindustrien im Allgemeinen und in der Elektrotechnik, der Chemiefaser-Industrie, im Maschinenbau und in der Feinmechanik/Optik im Besonderen. Es waren dies alles Industriezweige, die vom Wiederaufbau nach 1945 stärker gefördert wurden und innerhalb derer sich der wirtschaftliche und technische Fortschritt zuerst und spürbar niederschlug.
Als Ergebnis dieses negativen Struktureffektes lag das Produktionsvolumen der Industrie (einschließlich Bauwirtschaft) im Jahre 1952, das eine Zäsur in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes bedeutet, in Nordrhein-Westfalen nur um 35 Prozent über dem Stand von 1936, während es in der Bundesrepublik um 44 Prozent gestiegen war.8 Einer der Gründe dafür liegt in der anfangs geringen Aufnahmefähigkeit Nordrhein-Westfalens für Flüchtlinge und für verlagerte, ehemals in Ost- und Mitteldeutschland und z. T. auch in Berlin beheimatete Betriebe. Der neue Industrialisierungsprozess, den die Abtrennung dieser Gebiete, vor allem aber der starke Bevölkerungszugang aus dem Osten beinahe zwangsläufig auslösen musste, hat das alte industrielle Zentrum ausgespart, um dafür um so stärker in den südlichen Bundesländern anzusetzen. Dort schossen neue Industriestandorte aus dem Boden, die aus dem Reservoir der in den Westen verlagerten Arbeitskräfte schöpfen konnten. Nordrhein-Westfalen war bis in die fünfziger Jahre hinein nicht in der Lage, an diesem Mobilisierungsprozess und Strukturwandel angemessen zu partizipieren. Wohnraummangel und Zuzugsperren lenkten den Strom der Ost-West-Wanderung am Ende des Krieges und in den ersten Nachkriegsjahren an Nordrhein-Westfalen vorbei. Der Anteil der Vertriebenen an der Gesamtbevölkerung war deshalb 1946 hier mit 6,1 Prozent besonders niedrig, während Länder wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern eine Vertriebenendichte von 32,9 respektive 24,0 und 18,9 Prozent aufzuweisen hatten.9
Dort, wo es gelang, Flüchtlinge und Flüchtlingsindustrien gezielt zusammenzuführen, wie z.B. im ostwestfälischen Espelkamp, zeigte sich rasch, welche Chancen darin lagen. Zwar ging das ursprüngliche Konzept nicht auf, die Großindustrie des Ruhrgebiets zur Gründung von Filialen zu bewegen, um die ‚ungesunden’ und in der unmittelbaren Nachkriegszeit weitgehend unbewohnbaren Ballungsgebiete zu entlasten. Es gelang aber doch, ein scheinbar unerschöpfliches Reservoir an einsatzbereiten und fähigen Menschen für den Aufbau eines neuen High-Tech-Industriestandorts zu nutzen, der sich als wenig krisenanfällig und noch dazu international wettbewerbsfähig erwies.10 Im Vergleich mit Süddeutschland blieben solche positiven Erfahrungen aber eher die Ausnahme. Noch im Jahre 1957 lag der Vertriebenenanteil in Nordrhein-Westfalen mit 15,3 Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 17,9 Prozent.11 Entsprechend schwach waren die Heimatvertriebenen unter den Erwerbstätigen vertreten. Kurzfristig gesehen konnte sich Nordrhein-Westfalen dadurch einer Bürde entziehen, die das Sozialbudget anderer Bundesländer außerordentlich belastete und zur hohen Arbeitslosigkeit dort nicht wenig beitrug. Andererseits fehlten aber gerade an Rhein und Ruhr wichtige Antriebskräfte, die in den fünfziger Jahren anderenorts erheblich zur wirtschaftlichen Mobilität und zur Diversifikation der Industriestruktur geführt hatten. Die begrenzte Aufnahmefähigkeit des Landes wurde nahezu völlig von den Bedürfnissen der ‚alten‘ Branchen absorbiert, die – wie der Kohlenbergbau – in der ersten Phase des Wiederaufbaus von entscheidender Bedeutung, langfristig gesehen aber wachstumsschwache Industrien waren.
Unter diesen Bedingungen litt Nordrhein-Westfalen schon in den frühen fünfziger Jahren unter der Oberfläche seines Reichtums sowohl unter den negativen Effekten einer wachstumshemmenden industriellen Ausgangsstruktur als auch unter den Auswirkungen von regionalen Standortverschiebungenzu seinen Lasten. Beide Effekte zusammen kosteten das Land in den Jahren 1950 bis 1958 – also noch vor dem Einbruch der Bergbaukrise – rechnerisch mehr als 210.000 Arbeitsplätze, wobei Bayern mit mehr als 100.000 zusätzlichen Stellen am meisten von dieser Entwicklung profitierte und ein Entwicklungsgefälle zu seinen Gunsten auslöste.12 Diese Gewichtsverlagerung vollzog sich schon während der ‚Prosperitätsphase‘ der nordrhein-westfälischen Wirtschaft. Sie verstärkte sich noch dramatisch, nachdem die latente Strukturschwäche mit dem Ausbruch der Kohlenkrise offenkundig geworden war. Zwischen 1958 und 1962 – also bis zum Ende der Rekonstruktionsperiode der westdeutschen Wirtschaft – musste das Land erneut einen durch Strukturwandel verursachten relativen Nettoverlust von 182.000 Arbeitsplätzen hinnehmen, das waren 6,4 Prozent aller 1962 in der Industrie des Landes beschäftigten Personen. Das Tempo des Niedergangs hatte sich mittlerweile fast verdoppelt. Die Industrie an Rhein und Ruhr hat über die gesamte Rekonstruktionsperiode hinweg mit dem Expansionstempo des übrigen Bundesgebiets nicht Schritt halten können. Dies war nicht nur eine Folge regionaler ‚Entwicklungslogik‘, die alte Industrieregionen langsamer wachsen lässt als junge. Die Strukturschwäche der nordrhein-westfälischen Wirtschaft war vielmehr auch das Resultat einer Wirtschaftspolitik, die um des Wiederaufbaus der Wirtschaft des gesamten Bundesgebiets Willen und aus anderen übergeordneten Gesichtspunkten negativ wirkende Strukturfaktoren für das Land in Kauf nahm.
Resümee
In der Blütezeit des Reviers, den fünfziger Jahren, war dort jeder dritte Arbeitnehmer in Betrieben beschäftigt, deren Existenzgrundlage Kohle und Stahl waren. Nimmt man die mittelbare Abhängigkeit hinzu, so dürfte sogar jeder zweite Arbeitnehmer von der Montanwirtschaft gelebt haben. Dieser politisch verordnete Aufschwung der Grundstoffindustrie stand einer nachindustriellen Neuordnung Nordrhein-Westfalens in der Rekonstruktionsperiode der westdeutschen Wirtschaft im Wege. Es war gerade diese Zeit, die wie keine andere die Chance zum Strukturwandel und zur Modernisierung bot. Die Dynamik des Rekonstruktionsprozesses, die dem übrigen Bundesgebiet ein ‚Wirtschaftswunder‘ bescherte, wurde an der Ruhr von ‚alten‘ Industrien absorbiert, deren Ankurbelung aus rüstungs- und wiederaufbaupolitischen Gründen kurzfristig geboten erschien, die aber schon auf mittlere Frist ihren Niedergang fortsetzten.
Diese kritische Sicht des ‚Aufbau West‘ ist nicht nur dringend nötig, um die spätere ‚Strukturkrise‘ der nordrhein-westfälischen Wirtschaft von ihren Ursachen her zu verstehen. Sie kann uns auch dabei helfen, die schwierigen Anfänge des ‚Aufbaus Ost‘ und seine für viele Beobachter überraschend lange Dauer besser in die jüngste deutsche Wirtschaftsgeschichte einzuordnen. Wie Nordrhein-Westfalen nach 1945 litten auch die neuen Bundesländer unter einer veralteten Industriestruktur, die sich bis 1989 im östlichen Weltmarktsektor in anachronistischer Weise gegen den Trend der Neuen Wirtschaft behaupten konnte.13 Anders als Nordrhein-Westfalen kamen die alten Industrien der neuen Bundesländer nach dem Mauerfall aber nicht in den vorübergehenden Genuss eines Aufbaubonus. Sie wurden ohne Schonfrist dem Schock der Anpassung an die Regeln der Neuen Wirtschaft ausgesetzt. Ob dies politisch klug war, ist fraglich. Es könnte aber die notwendige Anpassungsfrist im Ergebnis verkürzen.
Fußnoten
- HStAD, NW 367-174.
- Mitteilungen des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Jg. 4 (1953), H. 9/10.
- Abelshauser 2004, S. 71–73.
- Abelshauser 1984, S. 15–20.
- Auf der Grundlage der Indexziffern der industriellen Produktion des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden bzw. des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen berechnet bei: Abelshauser 1988. Gruppenbildung nach dem Kriterium, ob sie im Wachstum von 1936 bis 1952 über dem Gesamtdurchschnitt lagen oder hinter ihm zurückblieben, gewogen nach ihrem Nettoproduktionswert von 1936.
- Adamsen 1981.
- HStAD, NW 53-101, p. 7 f.
- Wie Anm. 5.
- Stahlberg 1957, S. 9 f.
- Jander 1998; Oberpenning 1999.
- Lemberg / Edding 1959, S. 85.
- Baumgart 1965, S. 15.
- Zum Konzept der Neuen Wirtschaft s. Abelshauser 2003.