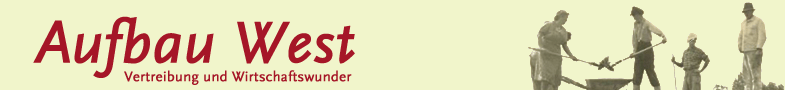Beginn des Inhalts/Link zum Seitenanfang| Link zur Seitennavigation|
Vortragsbegleitprogramm
Das LWL-Industriemuseum bietet zu den Themen des Internetportals ein breites Spektrum an Vorträgen an. Diese umfassen sowohl übergreifende Themen wie die Integration der Flüchtlinge oder die Situation von Flüchtlings-Frauen als auch spezielle Themen zu den Veränderungen in den jeweiligen Industriebranchen. Die Vorträge können mit historischem Bildmaterial oder Bildern aus der Ausstellung illustriert und in Einzelfällen mit historischem Filmmaterial ergänzt werden.
Die Wissenschaftler halten die Vorträge gerne bei Ihnen. Das Angebot kann über Frau Dr. Kift gebucht werden (Tel. 0231 6961-140).
- 1. Übergreifende Themen
- 2. Bergbau
- 3. Stahlindustrie
- 4. Wohnungs- und Siedlungsbau
- 5. Glasindustrie
- 6. Textil und Bekleidung
- 7. Maschinenbau
1. Übergreifende Themen
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kamen über 12 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene in die westlichen Besatzungszonen. Nach 1948 entwickelte sich Nordrhein-Westfalen zum Bundesland mit dem größten Flüchtlingsanteil in der BRD. In seinen Industrien trugen Flüchtlinge und Vertriebene maßgeblich zum Wiederaufbau bei: In der Montan- und Bauindustrie ersetzten sie fehlende Arbeitskräfte, in der Textil-, Bekleidungs-, Glas- und Maschinenbauindustrie siedelten sie neue Produktionszweige an.
Der Vortrag zeichnet die Industriegeschichte Nordrhein-Westfalens unter einem migrationsgeschichtlichen Gesichtspunkt nach. Die Nachkriegsgeschichte der einzelnen Industrien wird durch lebensgeschichtliche Beispiele ergänzt, die verdeutlichen, wie die Flüchtlinge und Vertriebenen sich in Nordrhein-Westfalen einlebten und gemeinsam mit den Einheimischen den oft schwierigen Neuanfang bewältigten.
Optional: Einführung in die Ausstellung mit „Rundgang“ durch die Abteilungen (Flucht und Vertreibung / Ablehnung und Hilfsbereitschaft/ Wirtschaft und Gesellschaft – Menschen und Schicksale / Spuren)
Leitkultur und Multikulti oder Parallelgesellschaften – das sind einige der Schlagworte, die die derzeitige Diskussion um Zuwanderung und Integration beherrschen und auf die Probleme verweisen, die die bundesrepublikanische Gesellschaft damit hat. Im Gegensatz dazu gilt die Eingliederung der Flüchtlinge und Vertriebenen in die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft immer noch als das Paradebeispiel einer gelungenen Integration – gelungen deshalb, weil sie ohne größere Probleme und anscheinend als Anpassung vonstatten ging. Funktioniert Integration aber nicht nach diesem Muster, treten Verunsicherungen auf und machen deutlich, dass man eigentlich doch noch nicht gelernt hat, damit umzugehen.
Die in den letzten Jahren verstärkt zusammengetragenen Lebensgeschichten von Flüchtlingen und Vertriebenen sowie ihren Kindern zeigen, dass auch der damalige Integrationsprozess durchaus von Brüchen und Problemen begleitet war und keineswegs als Einbahnstraße in Richtung Anpassung zu verstehen ist. Der Vortrag führt dies anhand einer Reihe lebensgeschichtlicher Beispiele aus, wobei der Schwerpunkt auf Themen wie dem Umgang mit den Erfahrungen von Flucht und Vertreibung, Erinnerungskulturen und kulturelle Orientierung in der Nachkriegsgesellschaft sowie auf der Frage des „Ankommens“ (inkl. den Rahmenbedingungen dafür) liegt. Abschließend zeigt er eine Reihe der Spuren auf, die die Flüchtlinge und Vertriebenen in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft hinterlassen haben.
Frauen, Kinder und Alte gaben Flucht und Vertreibung ein Gesicht: Während die Männer im Krieg oder in Kriegsgefangenschaft waren, trugen sie die Verantwortung dafür, dass die Familie überlebte, zusammenblieb und irgendwie wieder auf die Beine kam. Aus der Nachkriegszeit sind sie als Trümmerfrauen im Gedächtnis geblieben. Danach verschwinden sie von der Bildfläche, bis sie dann in der Werbung der 50er Jahre im Petticoat oder am Nierentisch wieder auftauchen. Das suggeriert, dass die Frauen offensichtlich wieder zu ihrer traditionellen Rolle als Hausfrauen und Mütter zurückgefunden hatten, während die Männer fest im Berufsleben standen und ihren Beitrag zum Wirtschaftswunder leisteten. Die Wirklichkeit vieler Flüchtlingsfrauen und -mädchen sah jedoch anders aus und auch die vieler Einheimischer. Anhand einer Reihe lebensgeschichtlicher Beispiele korrigiert der Vortrag das Bild der Geschichte der Frauen und ihrer Arbeit in Nachkriegszeit.
2. Bergbau
Nach dem Zweiten Weltkrieg trug vor allem der Bergbau Flucht und Vertreibung maßgeblich zum Wiederaufbau der Wirtschaft bei. Gleichwohl bremste ein eklatanter Mangel an Arbeitskräften die schnelle Wiederaufnahme der Produktion und ihre Steigerung. Militärregierung, Unternehmen und Arbeitsämter versuchten zunächst, ehemalige Bergleute wieder auf die Zechen zu holen – ob aus anderen Berufen oder aus Kriegsgefangenenlagern. Seit 1948 griffen sie in zunehmenden Maße auf Flüchtlinge und Vertriebene zurück und warben diese gezielt aus den Flüchtlingsaufnahmeländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern an. Bis 1953 wurden fast 800.000 Bergleute neu eingestellt. Geblieben sind jedoch weniger als ein Viertel.
Vor allem die Flüchtlinge, von denen die meisten keinen Bergbau-Hintergrund hatten, wanderten vielfach weiter: Durch Flucht und Vertreibung zwangsweise mobil geworden, blieben sie auch danach in Bewegung, wenn sich anderswo bessere Chancen boten. Um neue und alte Bergleute dauerhaft zu halten, modernisierte der Ruhrbergbau seine betriebliche Sozialpolitik und entwickelte eine neue Kulturpolitik, die ihrerseits zur Herausbildung einer neuen Revierkultur führte. Der Vortrag schlägt einen Bogen von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis zum Beginn der Strukturkrise.
Kohle war nach 1945 der mit Abstand wichtigste Energieträger, Grundstoff für zahlreiche Produkte und das einzige Exportgut, mit dessen Erlös auf dem Weltmarkt dringend benötigte Nahrungsmittel eingekauft werden konnten. Der Ruhrbergbau nahm somit im Wiederaufbau eine Schüsselstellung ein. Intensiver Raubbau während des Krieges hatte die Zechen unter Tage jedoch in einen desolaten Zustand versetzt, und die danach über Jahre offene Eigentumsfrage verhinderte die für eine Modernisierung notwendigen Investitionen. So waren es die Bergleute, die dafür sorgen mussten, dass die Produktion schnell wieder in Gang kam.
Nach der Befreiung der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen waren die Belegschaften jedoch halbiert und die verbliebenen Bergleute überaltert, unterernährt und anfällig für Krankheiten. Viele blieben der Arbeit fern, um angesichts der schlechten Versorgungslage durch Gartenarbeit, Hamsterfahrten ins ländliche Umland oder Schwarzmarktgeschäfte das Überleben ihrer Familien sicherzustellen. Eine massive Anwerbung von Neubergleuten in die Zechen an der Emscher sowie die Wiederbelebung der Kleinzechen an der Ruhr waren zwei Modelle, die Kohleproduktion wieder in Gang zu setzen und zu steigern. Diese Modelle werden im Vortrag näher vorgestellt.
1945 waren drei Viertel der Bergarbeiterwohnungen ganz oder teilweise kriegszerstört. Konnten schon die noch im Revier lebenden Menschen kaum untergebracht werden, verschärfte sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt weiter, als Tausende von neuen Bergleuten angeworben wurden, um die Produktion wieder in Gang zu bringen. Nach Verabschiedung des sog. „Kohlepfennigs“, einer Verbraucherabgabe auf die Kohle zur Förderung des Bergarbeiterwohnungsbaus, begannen 1952 im Revier Neubauaktivitäten bisher unerreichten Ausmaßes. Die Zechengesellschaften bauten Lehrlingsheime und Pestalozzidörfer, um aus den Flüchtlings-Aufnahmeländern angeworbene minderjährige Jugendlichen unterzubringen sowie Mietshäuser und Eigenheime für die erwachsenen Neubergleute. Vor allem hier sollten alte und neue Bergarbeiter, die häufig nur vorübergehend im Bergbau blieben, auf Dauer sesshaft werden. Der Beitrag stellt exemplarisch das Modell „Pestalozzidorf“, das Eigenheimprogramm der Gelsenkirchener Bergwerks AG in Dortmund und die Siebenbürger-Sachsen-Siedlung der Hibernia AG in Herten vor.
Viele Legenden ranken sich um die heilige Barbara. Allen gemeinsam ist die Verfolgung durch den heidnischen Vater, die Gefangenschaft in einem Turm, der Märtyrertod von der Hand des Vaters und dessen Bestrafung durch einen Blitzschlag. Aus diesen Elementen leitet sich auch die Funktion der Figur als Schutzheilige ab – für Mädchen, Gefangene und Sterbende (Lebensgeschichte), für Architekten, Maurer und Steinhauer (Turm), für Artilleristen und Waffenschmiede, Zimmerleute und Dachdecker, Glöckner und Glockengießer (Blitzschlag). Seit dem 14. Jahrhundert zählt die Heilige Barbara zu den 14 Nothelfern und erfuhr damit eine europaweite Verbreitung.
Eine Schutzheilige nur für Bergleute war die Barbara nie. Umgekehrt hatten die Bergleute in den alten (katholischen) Bergbauregionen neben ihr auch andere Schutzpatrone. In jüngeren Bergbauregionen wie dem Ruhrgebiet breitete sich die Barbaraverehrung der Bergleute erst allmählich aus. Um 1900 brachten sie polnische Zuwanderer mit, nach 1945 Flüchtlinge und Aussiedler aus Oberschlesien, wo die Barbaraverehrung besonders populär war. Kulturpolitiker aus dem
Bergbau nutzten die Barbara-Tradition, um Beruf und Ansehen des Bergmanns aufzuwerten. Sie modernisierten sie gleichzeitig, um aus einer katholischen Heiligen eine überkonfessionelle Schutzpatronin für alle Bergleute zu machen.
Schwerpunkt des Vortrags ist die Verbreitung und Modernisierung der Heiligen Barbara im Ruhrbergbau in den 1950er Jahren.
Nach dem Zweiten Weltkrieg trug vor allem der Bergbau maßgeblich zum Wiederaufbau der Wirtschaft bei. Gleichwohl bremste ein eklatanter Mangel an Arbeitskräften die schnelle Wiederaufnahme der Produktion und ihre Steigerung. Militärregierung, Unternehmen und Arbeitsämter versuchten zunächst, ehemalige Bergleute wieder auf die Zechen zu holen – ob aus anderen Berufen oder aus Kriegsgefangenenlagern. Seit 1948 griffen sie in zunehmendem Maße auf Flüchtlinge und Vertriebene zurück und warben diese gezielt aus den Flüchtlingsaufnahmeländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern an. Bis 1953 wurden fast 800.000 Bergleute neu eingestellt. Geblieben sind jedoch weniger als ein Viertel.
Die hohen Fluktuationsraten insbesondere der Neubergleute beunruhigten die Verantwortlichen im Bergbau über alle Maßen und dominieren die Literatur über die Bergbaugeschichte der Nachkriegszeit. Sie basieren aber in der Regel auf punktuellen Erhebungen, die weder langfristige Entwicklungen nachvollziehbar machen noch untereinander vergleichbar sind. Eine Untersuchung der Belegschaftsentwicklung anhand der Marken- und Lohnlisten der Zeche Zollern II/IV in Dortmund zwischen 1945 und 1955 geht erstmals systematisch und im Längsschnitt auf lokaler Ebene der Frage nach, wie sich die Belegschaft im Nachkriegsjahrzehnt entwickelte.
3. Stahlindustrie
Die alliierte Demontage deutscher Industrieanlagen gehört zum Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist einer der Gründe dafür, dass das Wirtschaftswunder als Wunder wahrgenommen wurde. Nach den Zerstörungen des Bombenkrieges folgte obendrein der Abbau bedeutender Produktionsanlagen und sogar ganzer Werke, die als Reparationsleistungen im Ausland wieder errichtet wurden. Dennoch - trotz dieser scheinbar massiven Hindernisse - stieg Deutschland binnen weniger Jahre nach dem Ende der Demontagen zu einer der führenden Industrienationen der Welt auf.
Eine der allgemein verbreiteten Erklärungen für diese Entwicklung ist, dass vor allem veraltete Produktionsanlagen demontiert und mit Hilfe alliierter Gelder aus dem Marshallplan durch modernere Anlagen ersetzt wurden. Gleichzeitig konnte angeblich ein Teil der Demontagen mit Hilfe der Amerikaner erfolgreich abgewendet werden. Dabei ist vor allem der gemeinsame Kampf aller gesellschaftlichen Kräfte Deutschlands gegen die Demontagen ein Bild, das bis in die Gegenwart verbreitet ist und dabei noch immer identitätsstiftend wirkt.
Der Vortrag soll anhand der Henrichshütte in Hattingen zeigen, wie sich die Demontagen - und der Abwehrkampf gegen sie – auf lokaler Ebene tatsächlich vollzogen und welche langfristigen Auswirkungen sie für den Wiederaufbau hatten.
4. Wohnungs- und Siedlungsbau
Der Zweite Weltkrieg verwandelte die deutschen Städte in Trümmerlandschaften. Insbesondere das Ruhrgebiet gehörte als Zentrum der Steinkohleförderung, Stahlerzeugung und Rüstungsindustrie seit 1940 zu den bevorzugten Zielgebieten der alliierten Luftangriffe. Viele der bei Kriegsende verbliebenen Einwohner hausten nur noch in Provisorien. Bald kamen trotz Zuzugssperre Tausende von Evakuierten, Kriegsheimkehrern und neu angeworbenen Bergleuten hinzu sowie nach 1948 all diejenigen Flüchtlinge und Vertriebene, die im Rahmen der Umsiedlungsprogrammen aus den Flüchtlingsaufnahmeländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern nach Nordrhein-Westfalen nach Nordrhein-Westfalen verlagert wurden. Für sie alle musste Wohnraum geschaffen werden, was angesichts der zerstörten Infrastruktur und des eklatanten Baustoffmangels eine große Herausforderung bedeutete. Anhand der Wiederbelebung der Baustoff- und Bauindustrie sowie des Wiederaufbaus der Innenstädte und des Siedlungsbaus zeichnet der Vortrag den Wiederaufbau des Reviers nach.
In Dortmund war das Ausmaß der Kriegszerstörungen besonders groß. Als die Stadt am 13. April 1945 durch amerikanische Truppen eingenommen und anschließend unter britische Militärregierung gestellt wurde, waren über 90% der Wohnungen im Stadtzentrum und jedes dritte Haus in ganz Dortmund zu 50–100% zerstört. Viele von den noch etwa 300.000 in der Stadt lebenden Menschen kamen nur notdürftig unter - und schon bald strömten Tausende von Menschen zusätzlich in die Ruhrgebietsstädte. Der schnelle Rückfluss der Evakuierten, der Kriegsheimkehrer und der beginnende Zuzug neu angeworbener Bergleute führte zu einer eklatanten Verschärfung der Wohnungsnot. Vom Wiederaufbau der Innenstadt über den Neubau von Werkssiedlungen mit Mietwohnungen und Eigenheimen bis hin zur Entstehung neuer Gartenstädte umreißt der Vortrag ein breites Spektrum von städtebaulichen Maßnahmen Bergbau in der Nachkriegszeit.
Wehrmacht und Rüstungsindustrie hinterließen 1945 riesige Areale mit Fabrikationshallen samt Infrastruktur (Häuser, Baracken, Straßen, Bahnanschlüsse), die von den Siegermächten zunächst demontiert und gesprengt, bald aber zur provisorischen Unterbringung von Flüchtlingen und Vertriebenen freigegeben wurden. Aus ihnen entwickelte sich eine Vielzahl von Siedlungen und Produktionsstätten, die die häufig abgelegenen Regionen, in denen sie entstanden, wirtschaftlich erschlossen. Bei den Neugründungen fallen als Initiatoren auf: Staat und Kommunen, die Kirche, und vielfach auch die Flüchtlinge und Vertriebenen in Eigeninitiative.
Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen stand dem Modell „Flüchtlingsstadt“ skeptisch gegenüber: Die Flüchtlinge und Vertriebenen sollten keine Gettos bilden, sondern sich in die Aufnahmegesellschaft integrieren. Industriepolitisch war man vor allem an Arbeitskräften für die klassischen Industrien des Landes und nicht an Konkurrenz dazu interessiert. Aus diesem Grund gibt es mit Espelkamp in NRW nur eine Flüchtlingsstadt, die zudem aus privater und kirchlicher Initiative entstand. Im Gegensatz dazu nutzte die Landesregierung von Bayern das wirtschaftliche und technische Potential der Flüchtlinge und Vertriebenen, um die Industrialisierung des Landes voranzutreiben. Die Flüchtlingsstadt Neutraubling war zeitweise der größte Arbeitgeber (auch für Einheimische) im Landkreis Regensburg und in einem Stadtteil von Kaufbeuren, bauten Glasmacher aus dem böhmischen Gablonz ihre weltbekannte Schmuckwarenindustrie wieder auf und brachten sie erneut an die Weltspitze. Die Flüchtlingsstädte Espelkamp, Neutraubling und Neugablonz stehen im Mittelpunkt des Vortrags.
Nach dem Kriegsende 1945 lag die deutsche Wirtschaft am Boden und die Revierstädte größtenteils in Schutt und Asche. Eine Vielzahl von Wohnungsbauprogrammen sollte dazu beitragen, zerstörten Wohnraum wieder herzurichten und neuen zu schaffen. An diesen Programmen beteiligten sich auch die Alliierten, insbesondere die Amerikaner. Über den Marshall-Plan und mit Hilfe der MSA (Mutual Security Agency / Amt für gegenseitige Sicherheit) wurden gewaltige Aufbaumaßnahmen finanziert, unter anderem neun große Bergarbeitersiedlungen. Die letzte dieser Siedlungen entstand zwischen 1952 und 1955 im Dortmunder Stadtbezirk Scharnhorst. Sie sah den Bau von 800 Einfamilieneigenheime für einheimische und zugewanderte Bergleute der nahegelegenen Schachtanlagen Scharnhorst, Kaiserstuhl und Gneisenau vor. Als Bauherrin zeichnete neben der MSA auch eine Tochtergesellschaft der Neuen Heimat. Ab 1955 wurden mit Hilfe des „Kohlepfennigs“ im Zentrum weitere 505 Mietwohnungen gebaut, dazu eine Ladenzeile mit Gaststätten. Der Vortrag zeichnet die Entstehung der Sieldung nach und vermittelt Einblicke in eine Mustersiedlung der frühen 50er Jahre, die sich an modernen Leitbildern des Wohnungs- und Städtebaus orientierte.
5. Glasindustrie
Im Verlauf der Industrialisierung hatte sich die Glasindustrie Bergbau mit besonderen regionalen Schwerpunkten entwickelt. In Westdeutschland konzentrierte sich die Flach-, Verpackungs- und Trinkglasindustrie mit großbetrieblicher Serienproduktion, der mittel- und ostdeutsche Raum einschließlich des Sudentenlandes war Standort der Kristall- und Spezialglasindustrie. Den nach 1945 vertriebenen und geflüchteten Glasmachern und –veredlern bot sich daher die Chance, bei einem Neubeginn im Westen diese Lücke zu schließen, ohne in übermäßige Konkurrenz zu bestehenden Betrieben zu geraten. Für die Städte und Regionen, in denen sie sich ansiedelten oder Firmen gegründet wurden, bedeutete dies, dass sie eine einseitige oder unzureichend entwickelte Wirtschaftsstruktur auflockern und bereichern konnten. Die wichtigsten Zentren der Glasproduktion und -verarbeitung waren Nordrhein-Westfalen, wo 40% aller westdeutschen Glasarbeiter beschäftigt waren, das Gebiet der oberen und mittleren Weser, Nordostbayern zwischen Coburg und Zwiesel, sowie Wertheim und Mainz, beide nach 1945 mit Hilfe thüringischer Fachleute neu aufgebaut und zu europaweit führenden Standorten entwickelt.
Der Vortrag vergleicht die Neuansiedlungen in NRW (Rheinbach und Borken) mit Beispielen aus dem süddeutschen Raum.
6. Textil und Bekleidung
Während der Industrialisierung war die deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie mit spezifischen regionalen Schwerpunkten gewachsen. Für NRW bedeutet dies z.B., dass im Westmünsterland die Baumwollindustrie dominierte, in Ostwestfalen die Leinenspinnerei und –weberei, im Aachen-Düren-Euskirchener Raum die Wollfabrikation, in Krefeld die Seidenindustrie, im Großraum Wuppertal die Herstellung von Bändern und Borten. Auf das Gebiet des Deutschen Reiches übertragen zeigt sich eine noch viel weiter gehende regionale Arbeitsteilung, die nach 1945 durch den Verlust der östlichen Provinzen, die Vertreibung der Bevölkerung sowie durch die Spaltung des übrigen Deutschland, durch Demontage und Sozialisierung mit daraus folgender Massenflucht aus der SBZ empfindlich gestört wurde.
Die Versorgung der westdeutschen Bevölkerung allein durch die westdeutsche Textilindustrie wäre angesichts der ungleichen Verteilung der Kapazitäten kaum möglich gewesen; Importe im großen Stil kamen schon aus finanziellen Gründen nicht in Frage. Hier lagen die Chancen für vertriebene Fachleute und Unternehmer, die im Westen neu anfangen wollten. Sie schlossen die vorhandenen Versorgungslücken und versuchten an die großen Exporterfolge der Vorkriegszeit anzuknüpfen. Die westdeutsche Textilwirtschaft erhielt so nicht nur die angesichts der gestiegenen Bevölkerungszahl notwendige quantitative Bereicherung, sondern auch eine qualitative Verbesserung ihrer Struktur. Die ungleiche Verteilung der Vorkriegszeit wurde weitgehend aufgehoben. Am Ende der Entwicklung gab es in Westdeutschland nahezu alle Produktionsarten, die vor dem Krieg über das ganze Reich verteilt waren.
Das Ende der alten Arbeitsteilung zwischen Ost und West hatte dann auch Konsequenzen für das Zusammenwachsen der Textilwirtschaft Westdeutschlands und der DDR nach 1990. Die technologisch zumindest teilweise rückständige DDR-Textilindustrie traf auf eine hochentwickelte, selbst im Überlebenskampf gegen ausländische Anbieter stehende westdeutsche Textilbranche, die eigentlich alles, was in der DDR hergestellt wurde, selbst produzieren konnte. Ein Anknüpfen an die alte Arbeitsteilung war kaum mehr oder nur in Teilen (z.B. Plauener Spitze, Lausitzer Leinen) möglich, der Aufbau Ost folglich zunächst mit einem Schrumpfungsprozess von gigantischen Ausmaßen verbunden.
Der Vortrag zeichnet diese Entwicklung anhand einzelner Firmengeschichten u.a. in Sprockhövel, Wuppertal, Bocholt, Borken und Rheinberg nach.
Gelsenkirchen, die Stadt der tausend Feuer, war eine der typischen schwerindustriellen Großstädte des Ruhrgebietes: Kohle und Eisen, mit Abstand gefolgt von Glas und Chemie, waren die dominierenden Wirtschaftszweige. Die Nachteile dieser Struktur – viele Frühinvalide, geringe Erwerbstätigkeit der Frauen, dazu Unsicherheiten hinsichtlich des Fortbestandes der Schwerindustrie nach dem Krieg – bewegten den Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau Dr. Wendenburg, die Bekleidungsindustrie Bergbau in Gelsenkirchen anzusiedeln. Während seiner Tätigkeit in Breslau 1939 – 45 hatte er die dortige Bekleidungsindustrie kennen gelernt. Jetzt suchten die dortigen Unternehmer nach neuen Standorten. Dr. Wendenburg holte sie in einer systematischen Suchaktion zusammen mit Firmen aus Stettin und Lodz nach Gelsenkirchen, wo sie mit über 50 Firmen und 6 – 7000 meist weiblichen Beschäftigten Mitte der 50er Jahre das fünfte Standbein der Gelsenkirchener Industrie bildeten.
Charakteristisch für die Industrie war die Gleichzeitigkeit traditioneller und moderner Produktionsweisen: von Verlagssystem mit Heimarbeit/Arbeit in kleinen Werkstätten und Fließbandarbeit in Fabriken. Der Übergang vom „Gewerbe“ in die „Industrie“ vollzog sich hier eigentlich erst in den 1950er Jahren. Ende der 1950er Jahre setzte zeitgleich mit der Kohlenkrise auch eine erste Krise der Bekleidungsindustrie ein, die u.a. zu einer Produktionsverlagerung ins ländliche Umfeld und langfristig nach Osteuropa und Asien führte (Stichwort Globalisierung).
Der Vortrag schlägt einen Bogen von der die Ansiedlung über die Modernisierung bis zum Niedergang der Bekleidungsindustrie in Gelsenkirchen und lässt dabei auch eine Reihe ehemaliger Beschäftigte zu Wort kommen.
7. Maschinenbau
Der Maschinenbau gehört zu Deutschlands Schlüsselindustrien und führenden Exportbranchen. Vor dem Zweiten Weltkrieg vor allem in Mitteldeutschland, insbesondere in Sachsen angesiedelt, profitierte die westdeutsche Maschinenbauindustrie nach 1945 sowohl durch die Abwanderung und Neugründung von Firmen aus der SBZ/DDR, in gewissem Umfang auch aus dem Sudetenland als auch durch den Zustrom von Maschinenbauingenieuren und sonstigen Fachkräften. Die neuen Maschinenbaufirmen ließen sich dabei nur teilweise in den traditionellen Zentren (v.a. im Rheinland) nieder. Sie suchen, bedingt durch die Verfügbarkeit von Fabrikhallen, dezentrale Standorte zwischen Kiel, Möhnesee und Naila. Der Wiederaufbau des westdeutschen Maschinenbaus unter erheblicher Beteiligung ehemals ostdeutscher Firmen stärkte die Wirtschaft Westdeutschlands, verhinderte nach 1990 aber auch ein Wiederanknüpfen an die alte regionale Arbeitsteilung. Ostdeutsche Maschinenbaufirmen, kapitalschwächer, technologisch zumindest teilweise rückständig und im Weltmarkt nicht verankert, hatten nun das Nachsehen.
Der Vortrag schlägt anhand einzelner Firmengeschichten und biografischer Beispiele einen Bogen von der Vorkriegszeit bis zu Gegenwart.