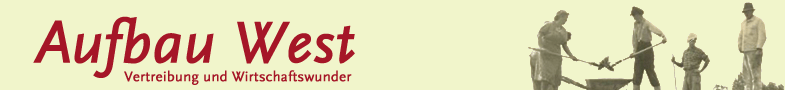Beginn des Inhalts/Link zum Seitenanfang| Link zur Seitennavigation|
Schlaglichter aus Osteuropa

Einen entscheidenden Impuls hatten die Versöhnungs- und Verständigungsprozesse durch die Entspannungspolitik Willy Brandts erhalten. Die Ostverträge seiner Regierung zeigten zudem auch innerhalb Osteuropas Wirkung: In den 1970er Jahren begann sich in Ungarn und Rumänien das Verhältnis zu den verbliebenen deutschen Minderheiten zu entkrampfen. 1989 gewährte Polen den im Land verbliebenen Deutschen Minderheitenrechte.1 Die polnischen Bischöfe hatten sich allerdings schon 1965 für eine Versöhnung engagiert, die Solidarnosc-Oppositionellen die Vertreibungsfrage erneut auf die Agenda gesetzt. 2 In der Tschechoslowakei war es unter anderen der tschechische Schriftsteller, Mitbegründer und Sprecher der „Charta 77“ und spätere Staatspräsident Vaclav Havel, der sich ebenfalls bereits vor 1989 um Versöhnung bemüht hatte. 2005 würdigte Premierminister Jiri Paroubek die vertriebenen, geflüchteten oder verbliebenen deutschen Antifaschisten.3
Parallel zur großen Politik begannen auch die Menschen in den Vertreibungsgebieten, sich mit dem Thema zu beschäftigen: „... gerade in den früheren deutschen Gebieten nehmen immer mehr Menschen das deutsche Erbe an und zeigen Mitgefühl für das Leid der Vertriebenen – nicht zuletzt, weil ihre eigenen Familien Opfer einer Zwangsumsiedlung aus Ostpolen wurden“, konstatierte Helga Hirsch für Polen.4 Lange Zeit stand hier wie in Tschechien ebenfalls nur die eigene Opferrolle im Vordergrund.

Dieser Perspektivenwechsel ist in Polen und Tschechien nicht immer unumstritten, gerade weil er die bisher ausschließliche Opferrolle in Frage stellt. Die jährlichen Auseinandersetzungen um die Benes-Dekrete auf den Pfingsttreffen der Sudetendeutschen, neue Entschädigungsforderungen, wie sie die „Preußische Treuhand“ unlängst wieder ins Gespräch brachte, aber auch die Diskussion um die Pläne des Bundes der Vertriebenen, in Berlin ein „Zentrum gegen Vertreibungen“ einzurichten, wecken altes Misstrauen und führen immer wieder zu einem Rückzug auf alte, verhärtete Positionen.10
Die Flüchtlinge und Vertriebenen bleiben nicht zuletzt deshalb ein „Stachel im Fleisch der Nationen“, weil sie in gewisser Weise die Personifizierung des schlechten Gewissens der Anderen darstellen: In den 1950ern erinnerte ihre Anwesenheit die Westdeutschen daran, dass sie vergleichsweise glimpflich und insgesamt viel zu gut davongekommen waren und nicht annähernd so viel hatten bezahlen müssen wie die Flüchtlinge und Vertriebenen. Im Verständigungsprozess zwischen Deutschland und seinen östlichen Nachbarn stellt das Vertreibungsgeschehen das für die Nachkriegsgeschichte Polens und Tschechiens prägende Bild von deutschen Tätern und polnischen bzw. tschechischen Opfern partiell in Frage: Die Geschichte der Entrechtung und Vertreibung der Deutschen zeigt, wie schnell aus Opfern auch Täter werden können, die ohne große Umstände die Methoden übernehmen, mit denen sich vorher die Täter als Täter ausgewiesen hatten. Sich dem zu stellen, ist nicht einfach. Befürchtungen, die Geschichte solle nun umgeschrieben werden, sind nachvollziehbar. Wenn dabei jedoch ein differenzierteres Bild entsteht, sollte man das in Kauf nehmen.

Eine Aufarbeitung der europäischen Vertreibungsgeschichte kann jede Nation nur für sich leisten und sie tut es dann, wenn die Zeit dafür reif ist.11 Die Erfahrung mit der Geschichte der Vertreibung der Deutschen zeigt, dass das manchmal Jahrzehnte dauern kann. Sie zeigt aber auch, dass es möglich ist, das Leid der eigenen Opfer zu thematisieren, ohne damit den Verständigungsprozess mit den Nachbarn zu unterminieren: über das eigene Leid reden zu dürfen, trägt dazu bei, auch das Leid der anderen anerkennen zu können, weil es Zusammenhänge zwischen dem eigenen Leid und dem der anderen verdeutlicht, gemeinsame Erfahrungen sichtbar macht und die Beteiligten einander näher bringt. „Mit dem Abstand der Zeit und einer größeren Unbefangenheit der Angehörigen der zweiten und dritten Generation wächst .. das Bedürfnis nach einer Aneignung unserer Geschichte als untrennbarer Einheit von Verbrechen und Leiden. ... In dieser Bewusstwerdung liegt letztlich die einzige Möglichkeit, unsere Gefährdungen, aber auch unsere Chancen zu erkennen und die Lösung im Dialog zu suchen: mit uns selbst und unseren Nachbarn.“
Was dabei herauskommen kann, zeigt unter anderem die am 9.11.2000 unter der Schirmherrschaft des deutschen und des tschechischen Präsidenten eingeweihte Wissenschaftliche Bibliothek in Liberec, vormals Reichenberg in Tschechien (www.kvkli.cz). Die Stadt war vor 1945 kulturelles Zentrum der Deutschen in Böhmen und hatte neben einer 1867 gegründeten tschechischen Vereinsbibliothek seit 1923 auch eine „Bücherei der Deutschen". Nach dem Einmarsch 1938 schlossen die Nationalsozialisten die tschechische Vereinsbibliothek und vernichteten ihre Bestände. 1945 schlossen die Tschechen die „Bücherei der Deutschen“ und konfiszierten ihre Bücher. Fast alle verbrannten 1954, als die neue Studienbibliothek Feuer fing. Die verbliebenen Bestände sind heute in der Wissenschaftlichen Bibliothek wieder zugänglich. Initiatorin des Projektes war Vera Vohlídalová, die aus einer antifaschistischen, deutsch-tschechischen Familie stammte. Bewusst wurde die neue Bibliothek dort gebaut, wo sich die jüdische Synagoge von Reichenberg befand, die die Nationalsozialisten 1938 mit zerstörten. Sie war eine der größten Synagogen Mitteleuropas. Die neue Synagoge ist in Form eines halben Davidsterns in den Bibliotheksbau integriert. Die Wissenschaftliche Bibliothek setzt nicht nur neue Akzente in der nicht immer rühmlichen Bibliotheksgeschichte einer Stadt. Unter ihrem Motto „Die wissende Gesellschaft schützt ihre Minderheiten" begreift sie die Minderheiten nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung.
Projekte wie dieses setzen den europäischen Vertreibungen des 20. Jahrhunderts Beispiele für ein friedliches und produktives Miteinander entgegen. Sie blenden dabei die historischen Erfahrungen nicht aus, sondern beziehen sie mit ein. Gerade damit bieten sie die Chance, wenigstens etwas von dem osteuropäischen Miteinander wieder auferstehen zu lassen, das in der Mitte des 20. Jahrhundert vernichtet wurde.
Fußnoten
- Gündisch 2005, S. 80. Dass die polnische Regierung diese Rechte im Herbst 2006 in Frage stellte, sei der Vollständigkeit halber erwähnt – und mit Absicht lediglich in einer Fußnote.
- Urban 2005, S. 158 und Faulenbach 2005, S. 192.
- Pesek 2005, S. 167 und 173.
- Hirsch 2004, S. 252.
- In Polen in den den Wettbewerben der Stiftung KARTA (www.karta.org.pl). Die Körber-Stiftung (www.koerber-stiftung.de), die den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten durchführt, hat u. a. eine Auswahl von Arbeiten aus den deutschen und polnischen Geschichtswettbewerben veröffentlicht; vgl. Wancerz-Gluza 2003.
- Kossert 2005, S. 361.
- Borodziej / Lemberg 2000/2003.
- u. a. Stanek 2002.
- Hesová 2005.
- Vgl. dazu u.a. Urban 2004, S. 190-194 sowie auch die Beiträge von Urban (zu Polen) und Pesek (zu Tschechien) im Ausstellungskatalog des Bonner Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: Flucht, Vertreibung, Integration 2006.
- Zum Stellenwert von Zwangsmigrationen in der (ost-)europäischen Erinnerungskultur vgl. u.a. Kruke 2006.
- Hirsch 2004, S. 224f.