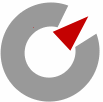|
NEU
Suchtinfo.net
|
|
|
<FreD> Das Projekt <Veranstaltungen> <Publikationen> <Partner> <Kontakt>
|
|
Laufzeit
des Projektes:
|
1. Oktober
2000 bis 31. Dezember 2002 Transferfase: 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003 |
|
Projektträger:
|
Landschaftsverband
Westfalen-Lippe |
|
Projektteilnehmer:
|
s. folgende Seite ... |
|
Wissenschaftliche
Begleitung: |
FOGS
Gesellschaft für Forschung und Beratung im Gesundheits- und Sozialbereich mbH Prälat-Otto-Müller-Platz 2 50670 Köln e-mail: fogs.koeln@netcologne.de Internet: www.fogs-gmbh.de Ansprechpartner: Herr Wilfried Goergen Herr Rüdiger Hartmann Herr Hans Oliva |
|
Juristische
Beratung:
|
Leitender
Oberstaatsanwalt Herr Karl-Rudolf Winkler Generalstaatsanwaltschaft Josef-Görres-Platz 5-7 56068 Koblenz |
|
Auftraggeber:
|
Bundesministerium
für Gesundheit DS 03 - Drogen und Suchtmittelmissbrauch Am Probsthof 78a 53121 Bonn Ansprechpartnerin: Frau MR'in Michaela Schreiber Internet: www.bmgesundheit.de |
Die
Ausgangssituation
Die Zahl junger Menschen, die mit legalen und illegalen Drogen experimentieren
ist in den letzten Jahren ständig gewachsen; ebenso die Zahl der drogenabhängigen
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Untersuchungen zeigen, dass bei jugendlichen
Drogenkonsumenten die Kenntnis bestehender Angebote gering ist, professionelle
Hilfe eher gemieden wird und Jugendliche von einem Mangel an Vertraulichkeit
und Verständnis ausgehen und Zweifel haben, ob sie dort wirklich Unterstützung
erfahren. Sie werden durch die Angebote der Sucht- und Drogenhilfe kaum erreicht.
Dies gilt auch dann, wenn ein riskanter bzw. schädlicher Konsum vorliegt.
Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die Gruppe der bereits problematisch
konsumierenden Jugendlichen und Heranwachsenden eher "unterversorgt"
ist.
Ziele
/ Zielgruppe
Um die Entwicklung deiner "Drogenkarriere" frühzeitig zu
vermeiden, hat die Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
(LWL) eine Konzeption "Frühintervention bei erstauffälligen
Drogenkonsumenten - FreD" entwickelt. Das Bundesministerium für
Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS) hat diese in Kooperation mit acht
Bundesländern als Modellprogramm augelegt. Die Leitidee des Modellprogramms
bestand darin, 14- bis 21-jährig, auch auch jungen Erwachsenen bis zum
25. Lebensjahr nach einer polizeilichen Erstauffälligkeit - vorrangig
in Verbindung mit § 31a BtMG (Absehen von Verfolgung) auf freiwilliger
Basis oder auch im Zusammenhang mit §§ 45 und 47 Jugendgerichtsgesetz
(JGG) nach Weisung - frühzeitig ein spezifisches (suchtpräventives)
Angebot zu machen. Die Ansprache der Zielgruppe erfolgte im Rahmen der polizeilichen
Erstvernehmung bzw. bis zur Mitteilung der (abschließenden) Entscheidung
durch die Staatsanwaltschaft.
Das Modellprogramm zielte u. a. darauf ab, erstauffälligen Drogengebrauchern fundierte Informationen über die verschiedenen Drogen, deren Wirkung und Risikopotentiale zu vermitteln, sie zur Reflexion des eigenen Umgangs mit psychoaktiven Substanzen anzuregen sowie zu Einstellungs- und Verhaltensänderungen zu motivieren. Grundlegendes Ziel war es zudem, die Entwicklung zu einem missbräuchlichen bzw. abhängigen Drogenkonsum sowie eine erneute strafrechtliche Auffälligkeit - verbunden mit ihren negativen Folgen - zu verhindern. An 15 Modellstandorten war das Angebot bei Trägern der Sucht- und Drogenhilfe angesiedelt. Es bestand aus einem Einzelgespräch (In-Take-Gespräch) und einem viermal zweistündigen Kursangebot. Die einzelnen Kurseinheiten wurden von den (Präventions-)Fachkräften methodisch-didaktisch vorbereitet und durchgeführt.
Ergebnisse
Die Teilnehmer/innen waren
durchschnittlich 17,7 Jahre alt und hatten hauptsächlich Cannabis (95,8
%) konsumiert. Darüber hinaus hatten sie neben Alkohol vor allem (gelegentliche)
Konsumerfahrungen mit MDMA/Ecstasy (11,5 %), Pilzen (7,7 %) und Amphetaminen
(6,7 %) gemacht, Heroin und Kokain hatten lediglich einzelne Jugendliche bereits
einmal konsumiert. Ein Drittel der Befragten hatte die hauptsächliche
konsumierte illegale Droge in einem 30-Tage-Zeitraum an bis zu sieben Tagen
konsumiert, immerhin 24,8 % gaben einen täglichen Konsum an. Als Gründe
für ihren Drogenkonsum gaben die Teilnehmer/innen überwiegend hedonistische
Motive an wie "Spaß haben" (77,7 %), "genießen"
(70,9%) bzw. stimmungsregulierende Aspekte wie "Entspannung" (65,9
%) an. Problembezogene Gründe wie z. B. "Schmerz empfinden"
(6,1 %) spielten bei den Befragten eine nachgeordnete Rolle. Ganz überwiegend
(89 %) hatten die Teilnehmer/innen bisher keine Hilfen im Zusammenhang mit
ihrem Drogenkonsum in Anspruch genommen. Die soziale Situation der Teilnehmer/innen
war vergleichsweise stabil und entsprach der ihrer Altergenossen. Sie lebten
entsprechend ihrem Alter überwiegend bei ihren Eltern (83,1 %). Sie gingen
entweder zur Schule (48,6 %) oder befanden sich in einer Berufsausbildung
(23,4 %) oder waren arbeitslos (7 %).
Von 514 Personen, denen im Erstgespräch eine Kursteilnahme empfohlen wurde, haben 446 Personen an den Kursen teilgenommen. Etwa jeder/jedem achten Gesprächspartner/in wurde die Nutzung weiterer spezifischer Hilfen angeraten. Von den Kursteilnehmer/innen haben 83,3 % den Kurs regulär beendet, was vor dem Hintergrund einer Freiwilligkeit der Teilnahme und der Altersstruktur der Teilnehmer/innen als ein gutes Ergebnis zu bewerten ist.
Mit den Kursinhalten und der Kursdurchführung waren die Teilnehmer/innen weit überwiegend (sehr) zufrieden, entsprechend fiel die Bewertung des Angebots aus: Das Kursangebot wurde von 87,5 % der Befragten mit (sehr) gut beurteilt, drei Viertel sind darüber hinaus bereit, das Angebot weiterzuempfehlen.
Zur Umsetzung des Angebots war eine enge Abstimmung zwischen der Drogenhilfe als Träger des Angebots und der Polizei und Staatsanwaltschaft erforderlich. Dabei zeigen die Modellerfahrungen, dass insbesondere in den Regionen die Umsetzung gelungen ist, in denen transparente und verbindliche Absprachen zwischen den Beteiligten getroffen wurden und ein pragmatisches und zielorientiertes Vorgehen gewählt wurde, das von gegenseitiger Akzeptanz und der Anerkennung der jeweils spezifischen Aufgaben und Kompetenzen geprägt war.
Zusammenfassung
Die Ergebnisse des Modellprogramms zeigen u. a., dass mit dem FreD-Angebot
| - | junge Konsumenten illegaler Drogen frühzeitig mit einem (sucht-)präventiven Angebot erreicht werden können, |
| - | das Modellkonzept mit einem Erstgespräch und Kursangebot, das von qualifizierten und erfahrenen Fachkräften durchgeführt wird, tragfähig im Hinblick auf die Teilnahmebereitschaft ist, |
| - | Wirkungen erzielt werden können, die sich in der durch die Teilnehmer/innen konstatierten persönlichen Bedeutung der Teilnahme ebenso ausdrücken wie in der Verbesserung des Wissensstands zu gesundheitlichen, sozialen und rechtlichen Aspekte des Drogenkonsums, einer verbesserten Risikoabschätzung, der Anwendung von Gebrauchsregeln oder auch im Konsumverzicht. |
Transfer
Das Jahr 2003
dient dem Transfer der Erfahrungen und Ergebnisse. Auf der Basis des Handbuchs
(Manual) und des Abschlussberichtes der wissenschaftlichen Begleitung finden
mehrere Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet statt. mehr
...