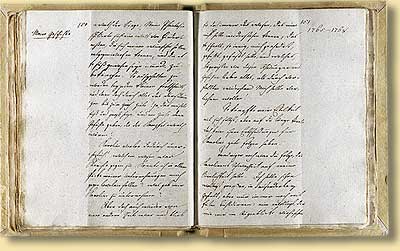|

|
|
Anton Matthias Sprickmann (1749-1833), Dichter der Sturm- und Drang-Zeit, Gelehrter und Jurist aus Münster, um 1795
Zeichnung von Carl Joseph Haas
Privatbesitz
Foto: WLMKuK Münster, Rudolf Wakonigg
Mehr zur Person Sprickmanns
|
Aus: Barbara Stollberg-Rilinger, Liebe, Ehe und Partnerwahl ..., S. 253ff:
„In seiner fragmentarisch überlieferten Autobiographie schildert Sprickmann, wie er als 18jähriger Student bei einem Besuch in Bonn ein Mädchen namens Karoline Meyer kennenlernte, die Schwester eines Juweliers, der nach dem Tod des Vaters zugleich ihr Vormund war. Sprickmann hatte selbst seinen Vater, einen Arzt, früh verloren und war von Mutter und Tanten unter materiell eingeschränkten Umständen in streng katholischer Frömmigkeit erzogen worden.
Sprickmann litt noch an den Folgen einer unglücklichen Liebe zu einer spröden Klosterschülerin namens Franziska in Münster, als Karoline, die er bei einem Konzert im Haus des Bruders traf, schon ‚einen neuen Tumult in seiner Seele‘ erregte – wegen ihres schönen Klavierspiels, wegen ihres „freundlichen, zwanglosen Betragens‘ und vor allem eines ‚gewissen Zug[es] von Gefühl in ihrem Gesichte‘. Was aber vor allem seine Gefühle für Karoline anfachte, war die Tatsache, daß er zur gleichen Zeit literarische Bekanntschaft mit der damals äußerst populären Heldin Klarissa aus Samuel Richardsons gleichnamigem Briefroman machte. Dieser Roman übte auf die empfindsamen Verhaltensideale der Zeit einen ungemeinen Einfluß aus. Er handelt davon, daß die tugendsam liebende Heldin Klarissa durch eine drohende Geldheirat in die Arme eines gewissenlosen Verführers getrieben wird, dem es aber bis in den Tod hinein nicht gelingt, ihren Widerstand zu brechen. Noch nie, so schreibt Sprickmann, sei eine literarische Gestalt seinem eigenen hohen Frauenideal so nahe gekommen. Mehr noch als in Klarissa verliebte er sich indessen mit narzißtischer Emphase in den männlichen Helden des Romans, den skrupellosen, aber glänzenden aristokratischen Libertin Lovelace. Von ihm habe er gelernt, daß man selbst solchen idealisch hohen Wesen wie Klarissa irdische Liebe abfordern dürfe‘.
|
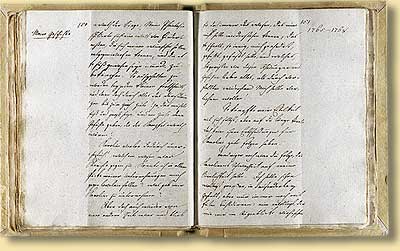
|

|
Autobiographie von Anton Matthias Sprickmann, nach 1781
Handschrift auf Papier, gebunden
19,8 x 30,6 cm (aufgeschlagen, S. 150f.)
ULB Münster, Sprickmann-Nachlass Bd. 18
Foto: ULB Münster, Gabriele Kortstiege
|
Rückblickend schildert Sprickmann mit subtiler psychologischer Beobachtungsgabe und erstaunlicher Selbstdistanz, wie die Identifikation mit Lovelace seinem eigenen Verhalten eine neue Wendung gab: Die kühle Zurückhaltung Franziskas, die er bis dahin als Bestandteil ihrer entrückten, idealischen Tugendhaftigkeit aufgefaßt hatte und die ihm zugleich ‚Jammer und Wonnen‘ bereitet hatte, begann ihn nun zu empören, ihr Widerstand kränkte seine Eitelkeit. Er wandte sich von ihr ab und Karoline zu, deren zutrauliches Betragen ihn „in der Anbetung seiner selbst‘ bestärkte. Ganz eins mit seinem Helden Lovelace, ‚hielt mich nichts mehr ab, und ich verstattete meiner Eitelkeit den Versuch meiner Kräfte und die Wahl Karolinens zum ersten Abenteuer meines ersten Ritterganges [...] jetzt strebte meine Eigenliebe nach Genüssen, die nicht freiwillig angeboten, die nur errungen und erkämpft werden müßten‘. – ‚Die ersten Schritte in kleinen Freiheiten geschahen schnell, ich wurde mit jedem Tage wagender, Karoline mit jedem nachgebender, jede zugestandene Freiheit beschleunigte die folgende. Diese Schwäche ihres Widerstandes brachte eine Menge trauriger Wirkungen hervor [...]. Die Gewohnheit zu siegen verringerte nach und nach den Wert der Siege.‘ Sprickmann konnte es Karoline nicht verzeihen, daß sie – ganz anders als die tugendsame Heldin Klarissa – ihm so wenig Gelegenheit zur Überwindung großer Hindernisse gab: sie ‚verlor dadurch unersetzlich!‘ Allerdings begann ‚Karolines Schwachheit‘ Sprickmanns höchst gespaltenes Frauenbild – ‚feile Buhldirnen‘ hier, idealische Phantasiegestalten dort – allmählich zu verändern: ‚Bisher [...] waren meine Gefühle für Weiber zwei äußerste Extremen gewesen: entweder hinreißende, witternde Wollust oder liebende, zurückzuckende Ehrfurcht. [...] Jetzt fing physischer Genuß an, mir ein Bestandteil, wenigstens ein möglicher Bestandteil im Gefühle der Liebe zu werden; ich fing an, Buhlerei mit Wesen als möglich zu begreifen, an die sonst mein kühnster Wunsch sich nicht versündigen gewagt hätte!‘ Indessen nützte das der armen Karoline wenig: Ihr Reiz für Sprickmann nahm immer mehr ab. Sie vermochte es nicht mehr, so klagt er, seinen Bildern von Reinheit und Unschuld ‚Leben der Wirklichkeit [zu] geben. Jedes Nachgeben, das in andern Stunden meiner Eitelkeit so schmeichelnd, meiner Sinnlichkeit so süß war, ward ein Ankläger gegen sie und ein Peiniger gegen mich, daß ich klagte, laut und gepreßt, hätt' ich, ach! hätt' ich Karoline nie gesehen!‘ – ‚Das Resultat dieses Krieges in mir war, der Angriff [nämlich auf das ‚letzte, äußerste‘] sollte geschehen! Und würde sie unterliegen, so sollte auf ewig gebrochen sein!‘ ‚Die Stunde des Nachgebens würde die letzte unseres Sehens gewesen sein.‘ Allerdings – in diese Falle ging Karoline nicht. Ihr ernsthafter, ungezierter Widerstand und ihre aufrichtige ‚Bitte um Schonung‘ rührten den Angreifer, ja nötigten ihm einen gewissen Respekt ab. In dieser Situation mischte sich Karolines Bruder und Vormund ein und warnte Sprickmann davor, die Ehre seiner Schwester einer bloßen Laune aufzuopfern. Diesem blieb nur die Wahl, den Umgang mit ihr abzubrechen oder sich mit ihr zu verloben. Er entschied sich spontan für das zweite: ‚Karoline hatte durch ihre letzte Standhaftigkeit zugleich meiner Eigenliebe, meinem Hang zur Wollust und dem letzten schwachen Reste meiner Tugend genug getan. Wie teuer sie mir war, fühlte ich nie inniger als jetzt, da ich ihr entsagen sollte.‘ Zwar sah er den Widerstand seiner Mutter voraus: ‚Sie bauete auf meine künftige Heirat so gewiß einen Teil ihrer liebsten Hoffnungen‘ und würde in die Heirat mit einem ‚fremden, armen Mädchen‘ kaum einwilligen, und ihm war klar, daß er durch diese Heirat zur ‚Sklaverei des Advokatenlebens‘, einem verabscheuten ‚Brotberuf‘ also, gezwungen sein würde. Doch gerade diese Hindernisse erschienen ihm in seinem von der Romanlektüre befeuerten Überschwang als philisterhafte Vorurteile. Es galt gerade, sich über die ‚Ungerechtigkeit des Glücks und der Geburt‘ um der Liebe willen hinwegzusetzen: ‚kannst du den Gedanken ertragen, jemals deine Hand zu verkaufen?‘ Indes – schon kurz nach der förmlichen, notariell beglaubigten Verlobung, auf der Karoline und ihr Bruder vor seiner Abreise aus Bonn bestanden hatten, kamen Sprickmann erhebliche Zweifel, die mit der Entfernung von der Geliebten wuchsen und durch die entsetzte Reaktion seiner Mutter bestärkt wurden. Je nachdrücklicher Karoline in ihren Briefen auf die Einlösung des Heiratsversprechens drang, desto mehr redete Sprickmann sich ein, ihr ganzes Benehmen sei von Anfang an ‚Lüge und Verstellung‘ gewesen und nur einem Plan des Bruders zur Versorgung seiner Schwester gefolgt. Als er erfuhr, daß Karoline sich gar hinter seinem Rücken um Unterstützung an seinen Mentor Fürstenberg gewandt hatte, löste Sprickmann empört die Verlobung – umso lieber, als er sich längst wieder einer anderen früheren Jugendliebe, Mariane, zugewandt hatte.“
|