Herrscher 1645/49 > Schweden
Schweden,
Christina von
(Kristina Augusta Vasa,
seit 1655: Christina Maria Alexandra)
(Stockholm 18.12.1626 - Rom 19.04.1689)
Königin von Schweden (reg. 17.11.1632 - , 17.12.1644 - resign. 16.06.1654)
Einzige überlebende Tochter Gustav II. Adolfs (1594-1632) und seiner Gemahlin Maria Eleonora von Brandenburg (1599-1655). 1627 als Erbprinzessin von den schwedischen Ständen anerkannt. Nach dem Tod des Vaters 1632 bei Lützen mit 6 1/2 Jahren am 15.03.1633 zur Königin proklamiert. Der irenisch gesinnte Theologe Johannes Matthiae übernimmt 1635 ihre noch von Gustav Adolf bestimmte, vom Regentschaftsrat überwachte Prinzenerziehung, Reichskanzler Oxenstierna ab 1638 ihre politische Ausbildung. Dezember 1644 Mündigkeitserklärung und Regierungsübernahme.
Der Distanzierungsprozeß von Oxenstierna führt 1647 zu Auseinandersetzungen über die Friedensverhandlungen, nachdem sie ihre Gesandten
 Johan Oxenstierna und
Johan Oxenstierna und  Johan Adler Salvius aufgefordert hatte, den Friedensprozeß zu beschleunigen. Als Ergebnis des Friedens erhält Schweden Vorpommern, Bremen und Verden und wird Reichsstand.
Johan Adler Salvius aufgefordert hatte, den Friedensprozeß zu beschleunigen. Als Ergebnis des Friedens erhält Schweden Vorpommern, Bremen und Verden und wird Reichsstand.Da sie eine Heirat ablehnt, setzt Christina im März 1649 die Anerkennung ihres Vetters Karl Gustav von Pfalz-Zweibrücken (1622-1660) als Nachfolger durch. Im Oktober 1650 erfolgt ihre Krönung in Stockholm, das die hochgelehrte Christina zu einem wissenschaftlichen und künstlerischen Mittelpunkt in Europa machen will. Die Kriegsgewinne Schwedens kommen ihr dabei zu Hilfe, Architektur und Künste zur Darstellung des neugewonnenen Status als Garantiemacht des Friedens, Führungsmacht im Ostseeraum und als evangelische Vormacht einzusetzen. Von den Gelehrten als Pallas suecia gefeiert, wird ihr im orthodoxen Schweden Verschwendungssucht und ihre Toleranz gegenüber anderen Religionen vorgeworfen. Um zum katholischen Glauben überzutreten, dankt sie am 06.06.1654 in Uppsala ab und verläßt Schweden.
In Brüssel vollzieht sie Weihnachen 1654 heimlich den Übertritt zur katholischen Kirche, dem im November 1655 der offizielle Übertritt in Innsbruck folgt. Dort beginnt ihre triumphale Reise durch Italien, wo die prominente Konvertitin im Dezember 1655 durch Papst Alexander VII. prunkvoll empfangen wird. Ihre Hoffnung, mit Unterstützung Mazarins präsumtive Königin von Neapel zu werden, zerschlagen sich ebenso wie die Bewerbung als nächste Wasa-Verwandte um den vakanten polnischen Thron nach dem Verzicht Johann Casimirs 1668. Erst 1681 kann sie in Schweden ihre Apanageansprüche endgültig sichern.
Sie bewohnt seit 1662 in Rom den Palazzo Riario (heute Corsini), in dem sie eine der größten Kunstsammlungen der Zeit aufbaut und auch für die Musik mäzenatisch wirkt. Sie hinterläßt in den 1680er Jahren verfaßte Memoiren und ca. 1400 Maximen. Am Morgen des 19.04.1689 stirbt sie in Rom und erhält Grab und Grabmal im Petersdom.
Ihr Porträt in Osnabrück entspricht dem von David Beck um 1648 geschaffenen Porträttyp, der 1649 sowohl von D. van den Bremden wie auch Jeremias Falck in Kupfer gestochen wurde. An ihn hält sich auch Merian im Theatrum Europaeum, während van Hulle für seinen Kupferstich das vom Hofmaler Sébastien Bourdon geschaffene, 1654 von Robert Nanteuil gestochene Bildnis als Vorlage verwendet.
Literatur
Theatrum Europaeum VI, S. 1179 (Abb.); Pacificatores 1697 Nr. 4 (Abb.); Meiern IV Schema Nr. 7; Bildnisse 1827 Nr. 37 (Abb.); Sixten Strömbom/Boo van Malmborg, Svenska kungliga porträtt. Bd I: Gustav I - Karl XII (Index över svenska porträtt band III.), Stockholm 1943, S. 202-249; Sven Stolpe, Königin Christine von Schweden, Frankfurt 1962; Katalog Christina. Queen of Sweden - a personality of European civilisation (Nationalmusei Utställningskatalog 305), Stockholm 1966; Curt Weibull, Christina of Sweden, Göteborg 1966; Georgina Masson, Christina, Königin von Schweden, Tübingen 1977; Karl Eric Steneberg, Porträtt av Drottning Kristina, Lund 1978; Susanna Akermann, Queen Christina of Sweden and her Circle, Leiden 1991; Jörg-Peter Findeisen, Christina von Schweden. Legende durch Jahrhunderte, Frankfurt 1992.Hildegard Mertens-Westphalen
Quelle: H. Duchhardt / G. Dethlefs / H. Queckenstedt, "...zu einem stets währenden Gedächtnis", Die Friedenssäle in Münster und Osnabrück und ihre Gesandtenporträts", (=Osnabrücker Kulturdenkmäler, Bd. 8), Bramsche 1998, S. 180f.
Ein
 Kooperationsprojekt des Internet-Portals "Westfälische Geschichte" mit dem
Kooperationsprojekt des Internet-Portals "Westfälische Geschichte" mit dem  LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster (Kupferstiche), und dem
LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster (Kupferstiche), und dem  Rasch Verlag, Bramsche (Texte)
Rasch Verlag, Bramsche (Texte)
Devise in Kartusche
QVO FATA VOCANT VIRTUS SECVRA SEQUETVR.
Wohin das Schicksal ruft, wird die sichere Tugend folgen.
Wappenbeschreibung
Der Schild ist geviert und mit einem Herzschild belegt. In Feld 1 und 4 in Blau drei (2:1) goldene Kronen (Schweden); 2 und 3: in Blau drei silberne schräglinke Wellenbalken, überdeckt von einem roten, golden gekrönten Löwen [hier sechsmal von Rot und Silber schräglinks geteilt und mit einem silbernen Löwen belegt] (Gotland). Der Herzschild ist von Blau, Silber und Rot schrägrechts geteilt. überdeckt von einer goldenen Garbe mit abfliegenden Bändern [hier in Silber ein roter Schrägrechtsbalken, überdeckt von einer Garbe] (Wasa).
Auf dem Schild ruht eine offene königliche Krone mit perlenbesetzten Bügeln und Reichsapfel auf ihrem Kreuzungspunkt.




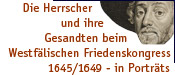








 Aufrufe gesamt: 5530
Aufrufe gesamt: 5530 