Gesandte 1645/49 > Langenbeck
Langenbeck,
Heinrich
(Hamburg 04.05.1603 - Celle 28.10.1669)
Prinzipalkommissar des Hauses Braunschweig-Lüneburg in Osnabrück, ab 1643
Aus einer seit Generationen in Buxtehude und Hamburg ansässigen Familie stammend, die zahlreiche Bürgermeister und Ratsherren gestellt hatte (sein Vater Johann war Oberalter im Hamburger Nicolai-Kirchspiel), studiert Langenbeck Philosophie, Geschichte und Jurisprudenz und wird 1631 in Straßburg mit der Dissertation "De cessione actionum" zum Dr. iur. promoviert. Langenbecks Ehe mit Anna Margaretha Schele bleibt kinderlos.
Im Mai 1634 tritt er als "Rat von Haus aus" in den Dienst Herzog Augusts d.J. (1579-1666), der seit 1604 in der kleinen Sekundogenitur Hitzacker residiert. Noch während der Erbstreitigkeiten im welfischen Gesamthaus nach dem Tode des Herzogs Friedrich Ulrich (11.08.1634) kündigt er im Frühjahr 1635 seinen Dienst auf und wechselt nach einem kurzen Aufenthalt in Hamburg im Herbst 1635 als Kanzlei- und Hofrat in die Dienste Augusts d.Ä. von Celle. Dessen Nachfolger Friedrich (1636-1648) befördert ihn 1643 zum Geheimen Kammerrat und entsendet ihn im selben Jahr als Prinzipal-Kommissar des Hauses Braunschweig-Lüneburg zum Westfälischen Friedenskongreß nach Osnabrück, wo er allerdings im Schatten des calenbergischen Gesandten
 Lampadius bleibt.
Lampadius bleibt.Von Herzog Christian Ludwig (1641-1648 in Hannover, 1648-1665 in Celle) 1651 zum Kanzler im Fürstentum Lüneburg ernannt, nimmt Langenbeck in dieser Position 1652 an der Braunschweiger Ministerialkonferenz zur Abstimmung der Politik des braunschweig-lüneburgischen Gesamthauses teil und wird im selben Jahr mit dem Dekanat des säkularisierten Stifts Bardewiek belohnt. In der Regierung bekleidet er die zweite Position hinter dem Statthalter Friedrich Schenck von Winterstedt und wird nach dessen Tod (1659) der leitende Staatsmann des Celler Hofes. In den welfischen Erbauseinandersetzungen nach dem Tode des Herzogs Christian Ludwig ergreift er 1665 die Partei Johann Friedrichs (1665-1679), der jedoch seinen Anspruch auf das Lüneburger Fürstentum nicht durchsetzen kann, sondern die Nachfolge in Calenberg-Göttingen mit der Hauptstadt Hannover antritt. Langenbeck dient dort Johann Friedrich als Geheimer Kammerrat, Konsistorialpräsident und Kanzler (seit 1668 zusätzlich mit der Pfründe des Propstes am Bonifatiusstift in Hameln versehen) bis zu seinem Tode. Seine umfangreiche Bibliothek vermacht er der Stadt Hamburg, wo er im Dom bestattet wird.
Literatur
Cools IV, S. 15; Theatrum Europaeum VI, S. 282 (Abb.); Aubry (Abb.); Pacificatores 1697, Nr. 88 (Abb.); Meiern IV Schema Nr. 25; Bildnisse 1827 Nr. 46 (Abb.); ADB 17, S. 662-64; Runge, S. 155; Striedinger Nr. 12; Katalog Gripsholm Nr. 251, Nr. 743.Gerd van den Heuvel
Quelle: H. Duchhardt / G. Dethlefs / H. Queckenstedt, "...zu einem stets währenden Gedächtnis", Die Friedenssäle in Münster und Osnabrück und ihre Gesandtenporträts", (=Osnabrücker Kulturdenkmäler, Bd. 8), Bramsche 1998, S. 258f.
Ein
 Kooperationsprojekt des Internet-Portals "Westfälische Geschichte" mit dem
Kooperationsprojekt des Internet-Portals "Westfälische Geschichte" mit dem  LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster (Kupferstiche), und dem
LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster (Kupferstiche), und dem  Rasch Verlag, Bramsche (Texte)
Rasch Verlag, Bramsche (Texte)
Devise
TEMPORE PACIS COGI - TANDVM DE BELLO ET VICISSIM.
In der Zeit des Friedens soll man an den Krieg denken und umgekehrt.
Kartusche
HENRICUS LANGENBEEK Serenissimo ac Celsissimo Principi, Domino FREDERIC0,
Brunsvicensium et Lunæburgensium Duci, â Consiliis intimis, ut et reru Cameralium, nec non Judicii Provincialis Assessor, et ad tractatus Pacis Universales Legatus Plenipotentiarius.
Wappenbeschreibung
Der Schild zeigt einen Wellenbalken. Auf dem bewulsteten Helm ein offener Flug.




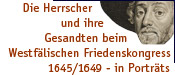








 Aufrufe gesamt: 3736
Aufrufe gesamt: 3736 