Ausstellungskatalog > V. Der Friede
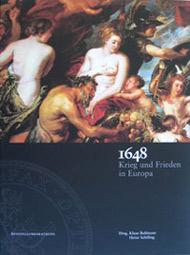
Ausstellungskatalog der
26. Europaratsausstellung
"1648 - Krieg und Frieden in Europa"
V. DER FRIEDE
Schon bald nach Beginn des Friedenskongresses stand fest, daß möglichst viele Konfliktparteien ihre Interessen wahrnehmen konnten, vor allem die Hauptkriegsmächte Frankreich, Schweden, Spanien, die Niederlande und der Kaiser, aber auch die meisten Reichsstände. Andere, wie Dänemark, Polen, Lothringen oder die Kurpfalz, blieben ausgeschlossen. Mit Ausnahme der katholischen Mächte, zwischen denen durch Vermittler verhandelt wurde, führten die Delegationen direkte Gespräche. Die Verhandlungen fanden vor der europäischen Öffentlichkeit statt, wie die Publikationen von Einzelvereinbarungen und Vertragstexten in mehreren Sprachen beweisen. Literaten wie der spanische Diplomat Diego Saavedra y Fajardo oder der Niederländer Johannes Cools verfaßten Friedensappelle, und auch bei Prozessionen oder in Stammbüchern wurde die Friedenssehnsucht spürbar.Der spanisch-niederländische Friede brachte der niederländischen Republik die völkerrechtliche Souveränität. Ihr Kolonialreich blieb unangetastet, und die benachteiligte Rechtsstellung der Katholiken in der Republik konnte von Spanien nicht verbessert werden. Das kaiserlich-französische Friedensinstrument beKatalogete neben den Friedenspräliminarien vor allem die "französische Territorialsatisfaktion": Einige Gebiete und Festungen sowie ein Bündel von verschiedenen Rechten in Lothringen und dem Elsaß gingen vom Reich an den französischen König über. Frankreich wurde Garantiemacht des Friedens und erhielt ein Interventionsrecht, wenn es künftig im Reich wieder zu Konflikten käme. Des weiteren wurde über italienische Territorien und Festungen entscheiden, die Souveränität der Schweizer Eidgenossenschaft anerkannt und vor allem die Amnestie für alle während des Krieges begangenen Untaten vereinbart.
Der Westfälische Friede war ein politischer Kompromiß, der eine anerkannte Rechtsordnung begründete, vor allem hinsichtlich formaler Bestimmungen wie dauerhafter Geltung in der christlichen Welt, Garantie, Amnestie und Antiprotestklausel. Wer wie der Papst auf kirchenrechtlich begründbaren Ansprüchen von vermeintlich ewiger Gültigkeit beharrte, schloß sich aus dem internationalen Zusammenspiel aus.
Das Bewußtsein für die Bedeutung des Kongresses äußert sich in den Bildnissen der Gesandten von Anselm van Hulle und Gerard ter Borch. Bereits während der Verhandlungen begann die Publikation von Stichserien mit den Gesandtenbildnissen. Sie richteten sich nicht mehr nur an die Herrscher und Heerführer, sondern auch an die Gesandten und Vermittler, die den Frieden ausgehandelt hatten. Die Städte Münster und Osnabrück zelebrierten ein ewiges Friedensgedächtnis, indem sie eine Galerie von Gesandtenbildnissen in ihren Rathäusern anbrachten. Ter Borchs Gemälde, auch als Radierung veröffentlicht, feiert die Beeidigung des spanisch-niederländischen Friedens im Münsteraner Rathaus und prägte damit zugleich das Bild späterer Friedenskongresse.
In allegorischen Flugblättern, auf Münzen und Medaillen finden sich zentrale Motive für die Deutung des Westfälischen Friedens. Fama, der Götterbote Merkur und der Postreiter als Figuren der Medien verkünden die Nachricht vom Frieden. Die neue politische Ordnung erscheint als einträchtige Verbindung des Kaisers mit Königin Christina von Schweden, König Ludwig XIV. von Frankreich und den acht Kurfürsten. War der Krieg als Strafe Gottes gedeutet worden, so erscheint nun der Friede als göttliches Gnadengeschenk: Pax kommt vom Himmel, die Taube bringt den Ölzweig, und als biblisches Zeichen des erneuerten Bundes nach der Sintflut wölbt sich der Regenbogen über die Erde.
Die Friedensfeiern zeigen vom obrigkeitlich geregelten Dankgebet über höfische Feste bis zu öffentlichen Inszenierungen ein weites Spektrum der Festkultur. Aus rechtlichen Gründen war es erforderlich, daß die Friedensschlüsse der Öffentlichkeit mitgeteilt wurden. Schon für die Verkündigung des spanisch-niederländischen Friedens im Juni 1648 wurden Schaugerüste vor Rathäusern errichtet. In Amsterdam zeigten Schauspiele die Überwindung des Krieges und den Gewinn der Freiheit. In zahlreichen Friedensfeiern bekunden die Stadtbewohner ihre Erleichterung über das Ende der Schrecknisse und die Hoffnung auf wirtschaftliche Prosperität.
Johannes Arndt / Hans-Martin Kaulbach
V.1. Gerechtigkeit und Friede
[ohne Einführungstext]
V.2. Der Weg zum Frieden
Ende 1641 vereinbarten kaiserliche, schwedische und französische Diplomaten in Hamburg, den Krieg auf einem Universalfriedenskongreß zu beenden. Als Kongreßorte wurden das katholische Münster und die konfessionell gemischte Stadt Osnabrück benannt; die Städte und die Verbindungsstraßen sollten neutralisiert werden. Auch die Lebensmittelzufuhr unterlag dem Schutz der Neutralität, die aber erst im Mai/Juni 1643 proklamiert wurde. Die kaiserliche Post bezog die Kongreßorte in ihre Routen ein. Wachtdienst und Verteidigung der Städte, auch die Herstellung der öffentlichen Ordnung organisierten die Stadträte. Diese vermittelten auch die Quartiere, die die Gesandtschaften von den Eigentümern anmieten mußten. Trotz der drangvollen Enge in den Kongreßstädten bestand ein gutes Verhältnis zwischen den Bürgern und den Gesandtschaften, wie etwa deren Patenschaften über Bürgerkinder bezeugen.V.3. Unter den Augen der Öffentlichkeit
Das Interesse der Öffentlichkeit an den Verhandlungen, die den Krieg beenden sollten, war enorm. Es spiegelte sich in begleitenden Flugschriften, aber auch in der Nachfrage nach den Gesandtenbildnissen, die um 1647/48 als Kupferstiche vervielfältigt wurden; erst Anfang 1646 waren mit der niederländischen Gesandtschaft die Bildnismaler Gerard ter Borch und Anselm van Hulle nach Münster gekommen. Letzterer arbeitete aber auch in Osnabrück. Manche Gesandte ließen ganze Galerien von Bildnissen ihrer Kollegen als Souvenirs fertigen. Gegenüber den Gesandten repräsentierte die Bürgerschaft die Öffentlichkeit, aber auch Journalisten wie der Holländer Johannes Cools. Man nutzte Prozessionen, das Schultheater der Jesuiten, aber auch den Buchdruck und selbst Stammbücher, um Friedensappelle an die Diplomaten zu richten und den Erwartungsdruck, bald Frieden zu schließen, zu erhöhen.V.4. Der Friedenskongreß in Münster
Zwischen den katholischen Mächten in Münster - Frankreich einerseits, Spanien und der Kaiser andererseits - erfolgten die Verhandlungen schriftlich über zwei Friedensvermittler, den päpstlichen Nuntius Chigi und den Venezianer Contarini, während Spanier und Niederländer in Münster und auch Schweden und Kaiserliche in Osnabrück direkt verhandelten. Zweiseitige Gespräche waren die Regel; nur die Reichsstände besprachen sich wie auf dem Reichstag in Kurien. Die Verhandlungen galten der Umsetzung der politischen, von den Diplomaten in Absprache mit ihren Regierungen getroffenen Entscheidungen in staatsrechtliche Formeln, in einen juristisch eindeutigen Vertragstext. Formulierungsvorschläge tauschte man schriftlich aus und verhandelte mündlich. Am Beispiel der Vermittlung Chigis über die Abtretung des Elsaß an Frankreich im September 1646 wird hier das Verfahren veranschaulicht.V.5. Die Friedensverträge
Während der spanisch-niederländische Friede einen achtzig Jahre dauernden Krieg beendete, stellte das Münsteraner Friedensinstrument den Friedenszustand zwischen dem Kaiser, dem Reich und dem französischen König wieder her. Die Niederländer gewannen durch ihren Frieden die völkerrechtliche Unabhängigkeit und behielten ihre Kolonien in Mittel- und Südamerika sowie im Indischen Ozean, während Frankreich sein Ziel, die Schwächung des Hauses Habsburg durch ein Gleichgewicht zwischen Kaiser und Reichsständen sowie zwischen Katholiken und Protestanten, erreichte. Alle Friedensschlüsse wurden bereits kurze Zeit nach der Unterschrift der europäischen Öffentlichkeit in gedruckter Form mitgeteilt. Das berühmte Gemälde von Gerard ter Borch "Die Beschwörung des spanisch-niederländischen Friedens" setzte dem Frieden ebenso ein Denkmal wie zahlreiche gemalte und gestochene Portraits der Friedensgesandten.
V.6. Pax optima rerum
Der lang ersehnte Frieden konnte nicht genug gelobt und gepriesen werden. Das historische Ereignis des Friedensschlusses sowie der friedensverkündende Postreiter fanden vielfältigen Eingang in die Bildmotivik des 17. Jahrhunderts. Der Krieg war beendet, der Kriegsgott Mars besiegt. Die Waffen ruhten endlich, und die Friedenspersonifikation Pax trat in den Vordergrund der bildlichen Darstellung. Die triumphale Rückkehr des Friedens wurde in allegorischen Ausschmückungen gefeiert und zierte Gedenkmünzen und Flugblätter. Das Ende des Krieges bedeutete gleichzeitig ein Erblühen des Handels und des Wohlstands. Auch die Gerechtigkeit hielt wieder Einzug und verband sich in der allegorischen Symbolik der Friedenszeit mit Pax zu einem geschwisterlichen Kuß.V.7. Die Friedensfeiern
Die Unterzeichnung der verschiedenen Friedensverträge, die dem ersten großen europäischen Konflikt ein Ende bereiteten, wurde in mehreren Festen von Mai 1648 bis 1650 angemessen gewürdigt. Die ersten Friedensfeste fanden in den nördlichen und südlichen Niederlanden statt; man feierte den Separatfrieden, der zwischen Spanien und den vereinigten nördlichen Provinzen am 15. Mai feierlich beschworen worden war. Mit einem mehrtägigen Festakt wurde der Frieden in Antwerpen, Amsterdam und Haarlem gefeiert. Die Antwerpener Rathausfassade schmückte eine aufwendige Festdekoration mit der zentral thronenden Friedensallegorie "Pax". Das Jahr des Nürnberger Hauptrezesses, 1650, war Anlaß zu zahlreichen großen und kleinen Friedensfeiern in Städten des Reiches sowie in Schweden. Die breite Vielfalt der Feierlichkeiten äußerte sich auch in Friedensumzügen, Theater- und Ballettaufführungen sowie in Friedensfeuerwerken. Spiegelungen des Friedens haben zudem die Literatur und Musik der Zeit geprägt.

Klaus Bußmann / Heinz Schilling (Hg.)
1648 - Krieg und Frieden in Europa. Ausstellungskatalog der 26. Europaratsausstellung. Münster 1998
- Einleitung / Inhalt
- Grußworte / Vorwort
- I. Die Krise in Europa um 1600
- II. Dramatis Personae
- III. Der Krieg - Realität und Bild
- IV. Die Schrecken des Krieges
- V. Der Friede
- VI. Der Friede und Europa
- VII. Die Städte der Friedensverhandlungen
- VIII. Glaube zwischen Krieg und Frieden
- IX. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation
- X. Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede - Ereignisse und Personen
- XI. Kunstraub und Beutekunst
- XII. Der Friede und das Reich





 Aufrufe gesamt: 4264
Aufrufe gesamt: 4264