Herrscher 1645/49 > Frankreich
Frankreich,
Ludwig XIV. von
(Saint-Germain-en-Laye 05.09.1638 -
Versailles 01.09.1715)
König von Frankreich (reg. 14.05.1643 - ,
1651/61 - 01.09.1715)
Sohn König Ludwigs XIII. von Frankreich (1601-1643) und der Anna von Österreich (1601-1666). Heiratet 1660 Maria Theresia (1638-1683), Tochter
 Philipps IV. von Spanien und der Elisabeth von Frankreich. Sie haben drei Söhne und drei Töchter. In zweiter heimlicher Ehe 1684 mit Françoise Aubigné, Marquise de Maintenon (1635-1692) verheiratet. Ferner unterhält er Beziehungen zu Louise Françoise de la Vallière (1644-1710) und Françoise Athénais de Rochechouart, Marquise de Montespan (1641-1707). Mit der ersteren hat er einen Sohn und eine Tochter, mit der letzteren drei Söhne und drei Töchter.
Philipps IV. von Spanien und der Elisabeth von Frankreich. Sie haben drei Söhne und drei Töchter. In zweiter heimlicher Ehe 1684 mit Françoise Aubigné, Marquise de Maintenon (1635-1692) verheiratet. Ferner unterhält er Beziehungen zu Louise Françoise de la Vallière (1644-1710) und Françoise Athénais de Rochechouart, Marquise de Montespan (1641-1707). Mit der ersteren hat er einen Sohn und eine Tochter, mit der letzteren drei Söhne und drei Töchter.Nach dem Tode Ludwigs XIII. wird die Regentschaft zunächst von Anna von Österreich und dem Kardinal Mazarin ausgeübt. 1661 tritt Ludwig selbst die Herrschaft an. Frankreich nimmt zu dieser Zeit aufgrund der erfolgreichen Politik der Kardinäle Richelieu und Mazarin eine Vormachtstellung in Europa ein. Der junge König, dessen politische Erfahrung maßgeblich durch den Adelsaufstand der Fronde geprägt ist, führt die absolute Monarchie zur Vollendung: Er konzentriert die Verwaltung, entmachtet die Parlamente und richtet eine Zentralregierung mit bürgerlichen Ministern ein, unter denen Colbert zunächst der einflußreichste ist. Dieser mobilisiert nach den Maximen des Merkantilismus die Finanz- und Wirtschaftspolitik, wodurch die Staatseinnahmen außerordentlich steigen. Der Herrschaftsanspruch des Königs, der bereits zu Lebzeiten als "der Große" und "Sonnenkönig" bezeichnet wird, manifestiert sich beispielhaft in dem 1661 begonnenen Schloßbau von Versailles. Seine prunkvolle Hofhaltung hat nicht zuletzt die Funktion, den Hochadel in die Klientel des Königs zu integrieren und an seine Person zu binden. Sein Herrschaftsstil und seine Selbstdarstellung werden von vielen Fürsten seiner Zeit als vorbildlich empfunden und nachgeahmt.
Während der gesamten Zeit seiner Regierung legt Ludwig besonderes Gewicht auf die Außenpolitik, die durch den Kampf um die europäische Hegemonie gekennzeichnet ist. Er schafft eine neue französische Seestreitmacht, organisiert den Aufbau der größten Militärmacht Europas und führt an der Nord- und Ostgrenze drei "Reunionskriege": 1667/1668 den Devolutionskrieg, 1672-1678 den holländischen Krieg und 1688-1697 den pfälzischen Erbfolgekrieg. Er erhebt dabei Anspruch auf alle Gebiete, die mit den 1648 an Frankreich gefallenen Territorien in Verbindung stehen, vor allem auf weite Teile des pfälzischen und rheinischen Gebietes sowie der spanischen Niederlande. Doch europäische Allianzen zwingen ihn 1697 im Frieden von Rijswijk in die Defensive und zum Verzicht auf die katalanischen und niederländischen Eroberungen sowie die rechtsrheinischen Reunionen. Im spanischen Erbfolgekrieg (1701-1714) zerbricht die französische Vormachtstellung unter Anerkennung des Systems des politischen Gleichgewichts in Europa.
Neben den großen innenpolitischen Leistungen des Königs, zu denen Gesetzgebungswerke auf dem Gebiet des Rechts, des Forstwesens und des Handels gehören, bringt seine auf das Staatskirchentum zielende Kirchenpolitik Auseinandersetzungen mit dem Papsttum und den Jansenisten und führt nach der Rücknahme des Ediktes von Nantes 1685 zu neuen Hugenottenverfolgungen.
Am Ende seines Lebens hat der König zwar seine dynastischen Ziele erreicht und die Gesamtfläche Frankreichs vergrößert, doch steht das Land, das seit den 1670er Jahren immer wieder durch Teuerungskrisen erschüttert wird, vor dem Staatsbankrott. Der Niedergang der absolutistischen Monarchie zeichnet sich bereits ab. Ludwig stirbt nach kurzer Krankheit und findet seine letzte Ruhestätte in St. Denis, während sein Herz in der Jesuitenkirche und seine Eingeweide in Notre-Dame in Paris beigesetzt werden.
Das Vorbild für das Porträt des jungen Königs mit blauer Ordensschärpe und dem Mantel des Ordre de Saint-Esprit in den Friedenssälen von Münster und Osnabrück ist nicht erhalten. Es war ein sicherlich in den französischen Gesandtschaften präsentes Staatsporträt, möglicherweise von Henri Testelin, von dem zwei Kinderbildnisse Ludwigs aus dem Jahr 1648 (eines sein Aufnahmestück in die Academie Royale) bekannt sind. Während Merian im Theatrum Europaeum einen fast gleich alten Typus kopiert, zeigt van Hulle Ludwig wesentlich älter als Jugendlichen.
Literatur
Theatrum Europaeum VI, S. 886 (Abb.); Kalender (Abb.); Pacificatores 1697 Nr. 3 (Abb.); Meiern IV Schema Nr. 4; Zedler, Sp. 1250-1395; Bildnisse 1824 Nr. 3 (Abb.); Striedinger Nr. 11 (Münster); Stammtafeln II, S. 18, 49; Philippe Erlanger, Ludwig XIV: das Leben des Sonnenkönigs, Frankfurt/Main 31987; J.-L. Thireau, Les idées politiques de Louis XIV, Paris 1973; André Corvisier, La France de Louis XIV: 1643-1715, Paris 1979; Jean-Pierre Labatut, Louis XIV: roi de gloire, Paris 1984; Roger Mettam, Government and Society in Louis XIV's France, London 1984; François Bluche, Louis XIV, Paris 1987; Pierre Gaxotte, Ludwig XIV. Frankreichs Aufstieg in Europa, Berlin 1988; Olivier Bernier, Ludwig XIV. Eine Biographie, Zürich 1993; Peter Burke, Ludwig XIV. Die Inszenierung des Sonnenkönigs, 1994; Klaus Malettke, Ludwig XIV. von Frankreich. Leben, Politik und Leistung, Göttingen 1994.Silke Wagener
Quelle: H. Duchhardt / G. Dethlefs / H. Queckenstedt, "...zu einem stets währenden Gedächtnis", Die Friedenssäle in Münster und Osnabrück und ihre Gesandtenporträts", (=Osnabrücker Kulturdenkmäler, Bd. 8), Bramsche 1998, S. 178f.
Ein
 Kooperationsprojekt des Internet-Portals "Westfälische Geschichte" mit dem
Kooperationsprojekt des Internet-Portals "Westfälische Geschichte" mit dem  LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster (Kupferstiche), und dem
LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster (Kupferstiche), und dem  Rasch Verlag, Bramsche (Texte)
Rasch Verlag, Bramsche (Texte)
Kartusche
LVDOVICVS. XIV. D. G. FRANCIÆ. ET. NAVARRÆ REX. CHRISTIANISSIMVS
Wappenbeschreibung
Im blauen Schild drei (2:1) goldene Lilien.
Auf dem Schild ruht die französische Königskrone mit dem lilienbesteckten Reif und der Lilienspitze. Den Schild umgeben zwei Ordensketten: innen die Kollane des St.-Michaels-Ordens, außen die des Ordens vom Heiligen Geist mit der Taube auf dem achtspitzigen Kreuz. Rechts und links die zwei Szepter des französischen Königs.



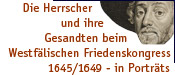








 Aufrufe gesamt: 4362
Aufrufe gesamt: 4362 