MEDIEN | (121 KB) 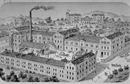 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Nadelfabrik St. Witte, Iserlohn, Stefanstraße, Villa Bellevue, Stennerstraße und Villa Carl Witte, Gartenstraße, Ansicht (Vogelschau) von Südwesten, um 1875 | |||||||||||||
| DATIERUNG | 1875 [um] | |||||||||||||
| INFORMATION | Die Gestalt der Gebäude ist wirklichkeitsgetreu wiedergegeben, ihre Anordnung ist dagegen idealisierend dargestellt. Ausgehend von dem Fabrikgebäude wurde die Villa Bellevue um ca. 90 Grad gegen Westen gedreht. Die Villa Carl Witte wurde vom Betrachter aus gesehen nach Westen versetzt. Die topographische Lage der Gebäude ist korrekt abgebildet. Die beiden Villen befinden sich auf der "Stennert" bzw. "Tyrol" genannten Erhebung nördlich der Innenstadt, während die Nadelfabrik östlich davon im Baarbachtal, dem sogenannten Weingarten, liegt. Die residenzartige Anordnung der Villen über der Fabrikanlage in einer alle Gebäude einschließenden Parklandschaft spiegelt zugleich die Aufsichts- und Kontrollfunktion des Fabrikherrn wider. So residieren die neuen Herren, die nach eigenem Selbstverständnis das Erbe des alten Adels angetreten haben. Nadelfabrik Stephan Witte, StefanstraßeDie Anfänge der um 1785 gegründeten Firma St. Witte & Co. sind in den Beteiligungen an verschiedenen Schleifmühlen zu suchen, die ursprünglich von dem Nadelfabrikanten Conrad von der Becke eingerichtet worden waren. Diese Schleifmühlen standen am Schluß eines viele Stationen umfassenden, dezentralen und arbeitsteiligen, auch teilweise heimgewerblichen Herstellungsprozesses von Nähnadeln. Die einzelnen Produktionsschritte waren: Schneiden, Geraderichten, Köpfe- und Öhrschlagen, Härten, Polieren, Zählen, Packen. Die Witteschen Schleif- und Poliermühlen lagen in der unmittelbaren Umgebung Iserlohns, am Westiger-, Caller- und Ihmerter Bach.Die Besitzer der Schleifmühlen befanden sich, da sie schließlich über die fertigen Nadeln verfügten, in einer monopolartigen Position. Aus dieser Position heraus begannen einige damit, allmählich einzelne Produktionsstufen zusammenzufassen. Am Ende dieses Prozesses stand die Fabrik mit dem arbeitsteiligen Produktionsablauf. Voraussetzungen für diese Entwicklung waren die zunehmende Verwendung von Arbeits- und Werkzeugmaschinen, der Einsatz der Dampfmaschine als Antriebsmaschine, vor allem aber die Beschaffung des erforderlichen Kapitals. Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei der Kettenproduktion zu beobachten. In der Regel begannen hier die Besitzer der Rollfaßanlagen - in Rollfässern wurden die fertigen Ketten poliert - damit, die dezentrale Produktion an einem zentralen Ort zusammenzufassen. Nach 1827 gingen die Inhaber dazu über, Teile der Nadelproduktion zu zentralisieren. Hierzu wurden am Ohl in unmittelbarer Nähe der Wohnhäuser der Familie Witte zunächst drei turmartige Fabrikhäuser errichtet. Über Produktionsabläufe und Arbeitsbedingungen liegt ein aufschlußreicher Augenzeugenbericht vor: "Die alte Fabrik bestand in der Hauptsache aus mehreren hohen, teilweise fünfstöckigen Fachwerkgebäuden mit steilen Treppen, dunklen Räumen und engen Winkeln. Damals wurden in der Fabrik viele Kinder, oft schon vom 7. Lebensjahr an, beschäftigt. Sie hatten es nicht leicht, da ihnen nicht nur das Reinigen und Putzen der Fabrikräume, das Anmachen und Unterhalten der Oefen und Oellampen, das Herbeischaffen und Kleinmachen von Holz, das Einspannen der Nadeln in Zangen beim Bläuen aufgetragen wurde; sondern sie wurden auch zu den vielen Transportarbeiten von einem Fabrikationsraum zum anderen benutzt, so daß sie den ganzen Tag treppauf und treppab zu laufen hatten, und oft soll - nach den Erzählungen alter Leute, die die damalige Zeit in der Nadelfabrik am Ohl noch miterlebt haben - die Behandlung dieser Kinder zu wünschen übrig gelassen haben, wenn sie nicht 'Werk halten' konnten." Die beengte Lage der Witteschen Nähnadelfabrik zwischen Ohl und Westertor ließ spätestens zu Beginn der 1860er Jahre die Entscheidung reifen, nach einem Grundstück zu suchen, das sich für den Bau eines neuen Fabrikgebäudes eignete. Mit dem nach 1864 errichteten Neubau parallel zur Baarstraße konnten endgültig alle Arbeitsschritte zusammengefaßt und der Zentralantrieb durch die Dampfmaschine rationell verwirklicht werden. So war es jetzt möglich, Schritt für Schritt die maschinelle Fertigung einzuführen. Zunächst konnte jedoch durch den neuen Standort am nahen Baarbach die Wasserversorgung und über einen eigenen Gleisanschluß die Kohleanlieferung für die Dampfmaschine verbessert werden. Mit der Gründung eines Preß- und Stanzwerkes 1893 versuchten die Inhaber den wiederholten Absatzeinbrüchen bei der Nadelproduktion entgegenzuwirken. Zunächst wurden Riemen- und Seilscheiben aus gepreßten Stahlblechen hergestellt. Gravierende Absatzschwierigkeiten veranlaßten den Unternehmer Friedrich Kirchhoff jedoch, diese Fertigung aufzugeben und die Produktion auf Puffer für Eisenbahnwagen, gepreßte Waggonteile sowie Achshalter und Konsolenlager für Güterwagen umzustellen. Diese Entscheidung war die Voraussetzung für den Fortbestand der Firma und die Sicherung des Firmenstandorts in Iserlohn - auch nach der Aufgabe der Nadelfertigung im Dezember 1954. Nach langer und kontrovers geführter Diskussion wurde das architektur- und technikgeschichtlich bedeutsame Baudenkmal an der Stefanstraße "nach Abwägung öffentlicher Interessen" 1982 abgebrochen. Der Gebäudekomplex mußte einer Straßenverlegung weichen. Die Firma selbst wurde in das neue Gewerbegebiet Sümmern-Rombrock verlegt, nur das 1970 errichtete Verwaltungsgebäude verblieb an der Stefanstraße. Villa Bellevue, StennerstraßeErläuterung s. Bild 2 Medien MedienVilla Carl Witte, Gartenstraße 48Den Bauantrag für dieses Gebäude stellte 1867 der Fabrikant Carl Witte. Damit wurde die erste Villa auf dem Tyrol errichtet. Der Architekt ist nicht bekannt. Es ist jedoch anzunehmen, daß die Villa nach einem Entwurf des Iserlohner Bauunternehmers Otto Schmidt ausgeführt wurde, da eine stilistische Ähnlichkeit mit der gegenüberliegenden Villa Ebbinghaus/Möllmann, die 1870 vom genannten Bauunternehmer errichtet wurde und heute die städtische Musikschule beherbergt, festzustellen ist. 1969 wurde die Villa Witte abgebrochen.Carl Witte (1830-1891) war Mitinhaber der Nadelfabrik St. Witte. Im Erbauungsjahr 1867 wurde ihm der Titel "Kommerzienrat" verliehen. Vor ihm erhielten diese Auszeichnung sein Onkel Hermann Witte, der darüber hinaus auch noch mit der Ehrenbürgerwürde der Stadt Iserlohn bedacht wurde, sowie sein Großvater Stephan Witte. Carl Witte war Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, ferner war er Vorsitzender der Sektion VI der Berufsgenossenschaft Feinmechanik. Er wohnte bis zu seinem Umzug in die Gartenstraße im Haus Ohl 7. Die Funktion der hier dargestellten Gebäude wurde für jeden Betrachter erkennbar durch die unterschiedliche architektonische Gestaltung der Fassade verdeutlicht. Die Fassade der Villa Bellevue gestaltete der Architekt im Stil der Renaissance. Er folgte damit den Vorstellungen des zu Wohlstand und Einfluß gekommenen bürgerlichen Mittelstands. Mit der Übernahme dieses Stils knüpfte man bewußt an die Blütezeit des städtischen Bürgertums im 15. und 16. Jahrhundert an. Der Neorenaissancestil wurde in Kunsthandwerk und Architektur geradezu zum deutschen National- und Volksstil. Neben den bürgerlichen Wohnbauten wurden viele Behörden und Schulgebäude in der Zeit nach 1870 in diesem Stil errichtet. In Iserlohn folgten diesen Gestaltungsprinzipien das Rathaus (1875), das Postgebäude (1882), das Gesellschaftshaus der Bürgergesellschaft (1897) und als Beispiel für die Schulgebäude die Königl. Fachschule für Metallindustrie (1900). Der aufwendig gestalteten Fassade der Villa steht die schlichte und fast kühle Architektur der Nadelfabrik an der Stefanstraße im Stil des preußischen Klassizismus gegenüber. Den Vorübergehenden sowie den hier Arbeitenden sollte immer gegenwärtig sein, daß an diesem Ort Ordnung und Disziplin herrschen. Die Anordnung der Gebäude - die Villen, entrückt auf einer Anhöhe, über der im Tal liegenden Fabrik - spiegelt zugleich den Anspruch immerwährender Aufsicht und Kontrolle wider. AnhangAus dem Reisebericht des Regierungspräsidenten H. F. A. Graf von ltzenplitz (Arnsberg) vom 30.07.1845:"Dicht bei der Stadt [Menden] liegt die bedeutende Papierfabrik des H. Ebbinghaus und die Fabrik von Schmöle & Romberg, welche 50-80 Arbeiter beschäftigt und in welcher Messing und Bronze gefertigt wird. Dasselbe Haus besitzt eine zweite Fabrik in Iserlohn, weiche die Produkte der ersteren weiter verarbeitet. Quelle: NW-Staatsarchiv Münster, RP Arnsberg, Nr. 450, fol. 24r-26r. | |||||||||||||
| TECHNIK | Lithografie | |||||||||||||
| FORMAT | jpg | |||||||||||||
| MASZE | 10 x 6 cm | |||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | Iserlohn, Stadtarchiv | |||||||||||||
| QUELLE |  Bettge, Götz | Kommerzienrat Friedrich Hermann Herbers | Dia 05, S. 28-34 Bettge, Götz | Kommerzienrat Friedrich Hermann Herbers | Dia 05, S. 28-34 | |||||||||||||
| PROJEKT |  Diaserie "Westfalen im Bild" (Schule) Diaserie "Westfalen im Bild" (Schule) | |||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2004-02-25 | |||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2025-11-12 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 3604 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 15 | |||||||||||||
 Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/med263 Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/med263 | ||||||||||||||
 zurück | zurück | Drucken / Speichern Drucken / Speichern Empfehlen Empfehlen Neue Suche Neue Suche Kommentar Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang Urheberrecht | Seitenanfang  | ||||||||||||||

