MEDIEN | (80 KB) 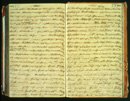 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Ausbildungsjahre Vinckes, Lebenshorizont: Der "Westfaleneid" - Seite aus seinem Tagebuch | |||||||||||||
| DATIERUNG | 1794-02-7 | |||||||||||||
| INFORMATION | Ludwig Vincke führte von seiner Schülerzeit auf dem Pädagogium in Halle (1789) an bis zu seinem Lebensende Tagebuch. Auf dem Pädagogium kam dieser persönlichen Rechenschaftslegung und Erforschung ein erzieherischer Zweck zu, und die Lehrer überwachten durch eine Kontrolle der Eintragungen die geistige und seelische Entwicklung der Zöglinge. Auch für den erwachsenen Mann war das Tagebuch kein strengstens gehüteter Ort privater Bekenntnisse, wie gelegentliche Niederschriften seiner Ehefrauen zwischen den eigenen offenbaren. Unverkennbar besitzt die Rechenschaftslegung einen religiösen Hintergrund; das Tagebuch entspringt einer calvinistisch-protestantischen Bekenntnis- und Rechtfertigungsethik. Die abgebildete Eintragung vom 7. Februar 1794 enthält in der linken Spalte den berühmten "Westfaleneid", den Ludwig als Erlanger Student leistete: "Mein Vaterland soll dereinst das Bild der vollkommensten Polizeieinrichtung abgeben, Landwirtschaft, Fabriken, Handlung, Schiffahrt sollen darin blühen, die Wissenschaften nicht weniger, eine glückliche gemeinnützige Aufklärung bis in die niedrigsten Klassen verbreitet werden, gute unverdorbene Sitten und ein rühmlicher Nationalcharakter den Westfalen auszeichnen. Wohlhabenheit soll allgemein mit Zufriedenheit des Lebens vereinigt sein, die Menschen glücklich sein, auch ohne diese Glückseligkeit auf das Spiel zu setzen durch eine unselige Revolution! Dazu wirken und tätig sein, das umfaßt mein ganzes Innerstes." Vergleicht man die Lebensleitlinien, die der 19jährige Student hier formuliert, mit seinem tatsächlichen späteren Wirken, so stellt man ein hohes Maß an Übereinstimmung fest. Als Oberpräsident der Provinz Westfalen erreichte er eine Position, die wie keine andere eine Chance bot, das anspruchsvolle Programm in die Realität überzuführen. Freilich blieben die im Überschwang der Jugend entworfenen Ziele weit von einer gänzlichen Erfüllung entfernt, doch es bedeutete viel, daß wirtschaftlicher Wohlstand, Aufklärung, Moralität, Glück der anvertrauten Bevölkerung in seinem Blick blieben. Der hochgesteckte Erwartungshorizont bedingte ein produktives Verhältnis zur Verwaltungswirklichkeit und qualifizierte Vincke als politischen Beamten, im Unterschied zum bloßen Fachbeamten. Vinckes Jugendjahre waren nicht nur für die Ausbildung eines starken Willens grundlegend, sie prägten auch spezifische Dispositionen wie sein späteres soziales Engagement. Dieses Engagement galt den rechtlich und wirtschaftlich Schwachen (Eigenhörigen, Tagelöhnern, Straffälligen), den körperlich und geistig Kranken, den Witwen und Waisen. Zur Ausbildung des sozialen Gewissens trug das Pädagogium in Halle maßgeblich bei. Tiefe Eindrücke sammelte er in der hessischen Universitätsstadt Marburg. Eine Art Schlüsselerlebnis stellte hier der Anblick einer Gruppe von Bauern dar, die auf dem Schloßberg schwerste Fronarbeit leisten mußten. Veränderungen nach Art der Französischen Revolution lehnte Ludwig aber bereits zu dieser Zeit ab; seine Distanz ist auch dem Westfaleneid zu entnehmen. Nicht zuletzt das sechssemestrige Universitätsstudium förderte Vinckes Überzeugung, daß das konkrete politische und administrative Handeln von theoretischen Vorgaben geleitet werden müsse. Sein Studium der Rechts- und Kameralwissenschaft war sehr breit angelegt, erfaßte neben dem engeren Stoffkanon so entlegen scheinende Gegenstände wie Medizin, Tiermedizin, Metallwirtschaft, Chemie, Botanik. In das Umfeld seiner theoretischen Neigungen gehörte die seinerzeit verbreitete Begeisterung für den schottischen Nationalökonomen Adam Smith. Als Referendar der Berliner Kriegs- und Domänenkammer nahm sich Vincke vor, täglich ein Kapitel aus den Schriften des liberalen Wirtschaftsphilosophen zu lesen. Sah er damals im Studium dieser Schriften noch eine Pflichtlektüre für Kameralisten, so machte er später doch Abstriche von der praktischen Anwendbarkeit der Freihandelstheorie. Insgesamt blieb Vinckes Denken und Handeln aber auch in der Folgezeit theorieoffen und -bezogen. Ausdruck findet diese Disposition z. B. in der Propagierung des englischen Selbstverwaltungsmodells, in der Einbringung zukunftsorientierter Denkschriften zum preußischen Reformwerk oder in seinem lebhaften Interesse an landwirtschaftlichen Mustergütern und Bildungsvereinen. Kompensiert wurde Vinckes theoretisch-pädagogischer Impetus durch intensive Kontakte mit Land und Leuten. Unzählige kleinere und größere Reisen - auch sie reiften in der Ausbildungszeit zur Gewohnheit heran - bewahrten ihn vor einem praxisfernen Verwaltungsverständnis. | |||||||||||||
| FORMAT | jpg | |||||||||||||
| OBJEKT-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv NRW / Staatsarchiv Münster | |||||||||||||
| OBJEKT-SIGNATUR | Nachlass Vincke, A I, Bd. 4, Bl. 233-235 | |||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, LWL-Medienzentrum für Westfalen/S. Sagurna | |||||||||||||
| QUELLE |  Burg, Peter | Ludwig Freiherr von Vincke | Dia 02, S. 27-29 Burg, Peter | Ludwig Freiherr von Vincke | Dia 02, S. 27-29 | |||||||||||||
| PROJEKT |  Diaserie "Westfalen im Bild" (Schule) Diaserie "Westfalen im Bild" (Schule) | |||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2004-02-23 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 3073 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 196 | |||||||||||||
 Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/med151 Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/med151 | ||||||||||||||
 zurück | zurück | Drucken / Speichern Drucken / Speichern Empfehlen Empfehlen Neue Suche Neue Suche Kommentar Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang Urheberrecht | Seitenanfang  | ||||||||||||||

