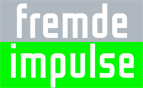Manufaktur und Tuchfabrik Scheidt
Johann Wilhelm Scheidt kaufte 1797 eine kopierte englische Vorspinnmaschine und läutete damit in Kettwig (heute zu Essen) das Industriezeitalter ein.
© Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln
Kapital zurück zur Auswahl
Englische Vorspinnmaschinen für Kettwig
An der Kirchfeldstraße in Kettwig – heute ein Wohngebiet – bahnte sich 1797 die Industrialisierung des Ortes mit einer technischen Sensation an: Johann Wilhelm Scheidt war erst ein Jahr zuvor in das 1720 gegründete Familienunternehmen eingetreten. Nun kaufte er eine Vorspinnmaschine, auf der ein einziger Arbeiter nicht nur einen, sondern viele Dutzend Vorgarnfäden gleichmäßiger und schneller produzierte, als es auf dem Spinnrad je möglich gewesen war.
Die Maschine ähnelte der englischen „Spinning Jenny“. Scheidt zahlte dafür 60 Taler – das Jahreseinkommen eines seiner Heimweber. Er bezog die Innovation nicht direkt aus England, sondern kaufte sie dem Geschäftsfreund Gottfried Wilhelm Brügelmann ab, der seit 1784 bei Ratingen eine Fabrik nach englischem Vorbild betrieb; heute gehört sie zum LVR-Industriemuseum. Know-how und Maschinenteile für diese erste Fabrik des Kontinents stammten weitgehend aus England. Baumwollfabrikant Brügelmann entwickelte die Maschinen weiter und verkaufte sie unter anderem an Scheidt, der Wolle verarbeitete und daher kein Konkurrent war.
Eine echte Fabrik war Scheidts Manufaktur hinter der bis heute erhaltenen klassizistischen Familienvilla von 1799 noch nicht. Dazu fehlte die zentrale Kraftquelle für den Antrieb der Maschinen, etwa ein Wasserrad oder eine Dampfmaschine. Versuche mit einem Pferdeantrieb scheiterten, die Maschinen blieben handbetrieben und die Firma eine dezentrale Manufaktur. Scheidt rüstete die neue Maschine vermutlich auf Wolle um und baute sie nach. Nun konnte im Kirchfeld zentral vorgesponnen werden. Heimspinner und -weber machten fertiges Garn und Tuch daraus.
Scheidts Tuchfabrik entstand schließlich 1837 am Ruhrufer in Kettwig. Hier wurde die Dampf- und ab 1902 auch die Wasserkraft genutzt. Alle Fertigungsschritte fanden an einem Ort statt; mechanische Webstühle ersetzten das Handwerk. Nach Bränden mehrfach ausgebaut, nahmen die Fabriken 1914 einen Großteil des Kettwiger Ruhrufers ein. Zum Unternehmen gehörte auch eine Kammgarnfabrik, deren ausgedehnten Sheddachhallen von 1911 stammten. Sie sind teilweise erhalten wie auch die heute zu Wohnzwecken umgebaute Tuchfabrik. Die Scheidt-Fabriken wurden durch Arbeiterhäuser und ein „Mädchenheim“ von 1906 ergänzt. Letzteres bot aus Ost- und Westpreußen angeworbenen ledigen Frauen eine Heimstatt, die einen Großteil der Arbeit in der Fabrik übernahmen.
Denkmale zum Impuls
Essen - Tuchfabrik Scheidt und Weberdorf Kettwig
An der Kirchfeldstraße 16 ist eine klassizistische Villa der Familie Scheidt von 1799 ... weiter
Essen - Die Scheidtsche Tuchfabrik an der Ruhr
Wenngleich sich mit dem Erwerb der ersten Vorspinnmaschine schon in den Manufakturgebäuden ... weiter