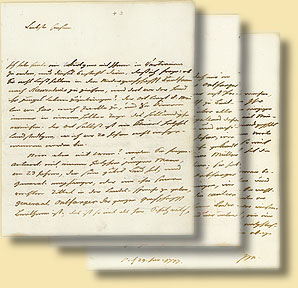|
|
|
|
Aus: Barbara Stollberg-Rilinger, Liebe, Ehe und Partnerwahl ..., S. 250ff:
Der berühmte, damals 57jährige Osnabrücker Regierungskonsulent Justus Möser schrieb im Juni 1777 an seine Lieblingsnichte, die 22jährige Johanna Catharina Friderici: ‚Ich habe heute ein Wörtgen im Vertrauen mit Ihnen zu reden, und dieses besteht darin, daß ich frage: ob Sie wohl Lust hätten, in der Niedergraffschaft Bentheim [...] zu ziehen und dort vor der Hand ihr junges Leben zuzubringen? [...] Nun aber mit wem? werden Sie fragen. Antwort: Mit einem hübschen, jungen Mann von 23 Jahren, der sein gutes Brod hat und Generalempfänger [...] der ganzen Grafschafft Bentheim ist; das ist soviel als hier Schatzrath‘. Dann beschreibt Möser ausführlich den familiären Hintergrund des jungen Mannes: der Vater Professor, die Mutter nicht ohne Vermögen. Er, der älteste Sohn, habe in Göttingen studiert und vor zwei oder drei Jahren sein Amt erhalten, wobei er unter 32 ‚Competenten‘ sein Glück gemacht habe. Möser hatte ihn kennengelernt, weil der junge Mann sich bereits um die Partie eines Mädchens beworben hatte, das bei Möser im Haushalt lebte, und zwar auf Vermittlung ‚des Herrn Landrentmeisters‘. ‚Er kam darauf hierher, und bey dieser Gelegenheit habe ich ihn kennen lernen. Aus dieser Heyrath ist nichts geworden, weil der Vater der M[ademoise]lle Balken andre Absichten mit seiner Tochter hat, und so habe ich ihm, indem ich ihm dies meldete, geschrieben, daß ich ihm einen andren Vorschlag aus meiner Verwandtschafft thun wollte, da ich selbst keine Tochter hätte, die ich ihm geben könnte. Denn der junge Mann gefiel mir sehr, und ich wünsche ihm eine gute Frau. Hierauf antwortet er mir, wie die Beylage zeigt‘. Möser berief sich damit auf den Brief des jungen Mannes, den er der Nichte mitschickte (leider ist er nicht erhalten), und fügte hinzu: ‚Ich wende mich jetzt an Sie: ob ich die Sache weiter fortsetzen soll?‘ |
|||
Ausführlich ließ sich Möser weiter über den potentiellen Bräutigam aus: ‚Nach meinem Urtheil ist er ein rechtlicher Mann, an dem nichts auszusetzen ist.‘ Manche sagten zwar, „daß er etwas würdig sey. Aber wahrhafftig, ein junger Mann, der zum erstenmahl an einen Ort kommt, sich als Freyer zur Schau stellen und manoeuvrieren soll, um zu gefallen, kramt wohl ein bisgen mehr aus, als er thun sollte; muß auch wohl etwas von sich sagen und auf sich halten, um zu zeigen, wer er sey. ‘ – „Eine schöne Bedienung, ein Alter von 23 Jahren, ein lebhafftes Temperament, gute Studia und etwas Lecture führen wohl jeden in Versuchung, etwas zu brillieren.‘ – ‚Und nun bitte ich Sie, liebste Cousine, die Sache mit dem Herrn Vater und der lieben Schwester zu überlegen. Es ist natürlich, daß Sie sich hierauf zu nichts erklären können, ohne den Mann gesehen zu haben, und daß er selbst kommen und sich zeigen muß. Allein ich wollte auch nicht gern, daß er so blos auf Geratewohl reisen und nicht wenigstens vorher versichert seyn sollte: daß Sie keine Einwendung gegen den Ort, die Bedienung und die übrigen Umstände haben, wenn Ihnen übrigens die Person gefallen sollte.‘ Schließlich fordert Möser seine Nichte noch einmal auf, alles reiflich zu erwägen und sich dann darüber rückhaltlos zu äußern: ‚Was Sie mir schreiben, bleibt unter uns [...] Sie können es dreist absagen [...] Mein einziger Wunsch ist nur, daß er nicht etwa aus Neugierde herübergezogen und dann zurückgeschickt werde. Jetzt kann ich ihm mit einem Worte melden: Sie hätten keine Lust, so weit von Hause zu ziehen, und damit hat die ganze Sache ein Ende.‘
In Mösers Worten wird deutlich, wie groß der Einfluß Dritter auf eine solche Eheanbahnung sein konnte, und welche Kriterien der Wahl für wichtig erachtet wurden: Alter, wirtschaftliches Auskommen, Elternhaus, Bildung, aber auch persönliche Ausstrahlung und Zuneigung, die allerdings in diesem Fall nur auf sehr oberflächlicher Kenntnis beruhen konnte – auf einmaligem Sehen nämlich. War es zu einer solchen inszenierten Begegnung erst einmal gekommen, so konnte man offenbar nur mehr schwer ohne Gesichtsverlust beider Seiten wieder zurück. Deutlich wird, wie heikel eine solche Begegnung war, wie leicht das persönliche Ansehen der Betreffenden dabei leiden konnte. Das illustriert auch der zweite Brief Mösers in dieser Angelegenheit, nachdem Johanna Catharina ihm positiv geantwortet hatte. Möser seinerseits hatte ihr Antwortschreiben dem jungen Mann, Carl Ludwig Buch war sein Name, postwendend zugeschickt, ohne sie um ihre Zustimmung zu fragen, und hatte damit die Regie des Ganzen vollständig in die Hand genommen. Dann gab er ihr eine Reihe präziser Verhaltensanweisungen für die bevorstehende Begegnung: ‚primo: Wenn der Herr Buch kommt, so erinnern Sie sich, daß Sie wissen, warum er kommt, und daß er weis, warum er sich sehen läßt. Ihre Augen können sich beyderseits hierüber gegen einander erklären und so offenherzig zu Werke gehen, daß ein jeder sich in seiner Lage völlig bequem fühlet.‘ Sie solle ihm gegenüber eine gewisse Verbindlichkeit und höfliche Dankbarkeit bezeugen, denn schließlich reise er beschwerliche vierzig Meilen nur um ihretwillen. Da er ja von ihrem Brief, mithin ihrem grundsätzlichen Interesse an seiner Person wisse, sei beiderseitige Offenherzigkeit angebracht. – ‚Pro secundo können Sie bey der ersten Gelegenheit, da Sie mit ihm allein sind, gleich mit dem Streiche anfangen, den Ihnen der böse Onkle durch Mittheilung des Briefes gespielet hat, und dadurch die Unterredung so fortführen, wie Sie solche im Briefe angefangen haben. Das wird Ihnen Gelegenheit geben, ihm für seine Bemühung zu danken und ihm zu versichern, daß, wenn auch Ihr Entschluß oder der seinige dereinst nicht mit der Absicht der Reise übereinstimmen sollte, Ihre Erkenntlichkeit doch allemahl unverändert bleiben würde. Auf diesen Ton können Sie die ganze Zeit Ihres Umgangs [...] reden, und Sie werden beyderseits unverlegen seyn. Denn dieser offenherzige und scherzhaffte Ton setzt jeden à son aise, verbietet alle grimace und führet zuletzt entweder zur Liebe oder zur Freundschafft. Denn wenn auch Ihre Bestimmung nicht füreinander seyn sollte, so müßen Sie doch beyderseits sich mit aller Freymüthigkeit trennen.‘ – ‚Pro tertio müßen Sie ihn in Ihre Protection nehme‘, das heißt, sie sollte dem Gast Hinweise für den Umgang mit ihren Hausgenossen geben und ihn auf Fehler, die er womöglich mache, hinweisen: Aus seiner Folgsamkeit lerne sie dann gleich am besten seinen Charakter kennen. – Und schließlich ‚pro quarto: Wenn Sie glauben, daß Sie beyderseits füreinander seyn werden, so lassen Sie ihn nicht mit leerer Hoffnung ziehen. Der Weg von Bentheim nach Blankenburg ist ein bißgen weit [...]. Es ist genug, [...] wenn er zweymahl kömmt.‘ – Eine perfekte Regieanweisung des Onkels also, der der Nichte mit größter Selbstverständlichkeit vorschreibt, wie sie es anstellen soll, vollkommene Offenherzigkeit zu mimen. Wie ging die Geschichte aus? Der Brautwerber traf mit einem Empfehlungsschreiben von Möser bei der Familie des Mädchens ein, fand aber offenbar nicht ihr Wohlgefallen und reiste ohne den erwünschten Erfolg wieder ab. Nur indirekt ist aus dem folgenden Briefwechsel zu entnehmen, daß Möser verärgert war über das mangelnde Entgegenkommen der Nichte und sich ihr gegenüber mit der Bemerkung Luft machte, ‚sie mögte sich einen malen lasse‘, mit anderen Worten ihre Ansprüche seien überzogen und illusionär. Darauf muß die Nichte sehr verstimmt reagiert haben, jedenfalls entschuldigte sich der Onkel in einem dritten Brief wortreich bei ihr für seine Entgleisung und beteuerte: ‚Sie können [...] versichert seyn, daß ich Ihren Entschluß in Ansehung des Herrn Buchs völlig billige und es Ihnen sehr verdacht haben würde, ihm ohne Neigung die Hand zu geben. Diese läßt sich nicht zwingen, und es ist mir genug, daß Sie mit ihm nicht sympathisirten.‘ Er hatte also durchaus Respekt gegenüber der Entscheidung des Mädchens, doch ihr Handlungsspielraum war durch das Arrangement des Onkels von vornherein klar umrissen. Sie durfte ja oder nein sagen, aber zu welcher Person, darüber stand ihr keine freie Auswahl zu.“ |
|||
Zum Seitenanfang  | |||

| Der LWL - | Freiherr-vom-Stein-Platz 1 - | 48133 Münster - | Kontakt - | Impressum |