
Foto: S. Sagurna / LWL-Medienzentrum für Westfalen.
24. - 26. September 2008
Konzept und Leitung: Dr. Eckhard Schinkel
(Oberkustos und Wissenschaftlicher Referent am LWL-Industriemuseum)
Die Tagung steht im Zusammenhang mit dem Ausstellungsprojekt "HELDEN" des LWL-Industriemuseums in Zusammenarbeit mit der Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010.
Zum Thema
"Heldinnen" und "Helden" sind ein "gesellschaftliches Faszinosum" (H. Münkler); an ihnen scheiden sich die Geister. Als Idole, Leitbilder, Vorbilder oder Stars können sie Bestandteile individueller und sozialer Entwicklungen in bestimmten Lebensabschnitten, in besonderen Lebensumständen und spezifischen Konstellationen der Gesellschaft sein (die Frage nach dem persönlichen Held im FAZ-Fragebogen; die Bildung heroische Gemeinschaften in einer unheroischen Gesellschaft). Helden-Bilder vermitteln Vorbilder und Muster in Geschichte und Gegenwart. Als Elemente des kollektiven Gedächtnisses können sie bestimmte Mentalitäten, Vorstellungen und Erfahrungen verkörpern und prägen.(U. Frevert) Ihre Wirkmächtigkeit ist das Ergebnis einer künstlerisch-medialen Darstellung und Überlieferung.
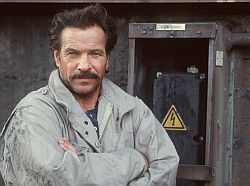
Foto: S. Falke / WDR
Eine besondere Rolle übernehmen "Helden-Bilder" als unterkomplexe Identitätsmuster im Spiel. Sie geben Teilnehmern und Zuschauern Gelegenheiten zur Triebentfaltung und -abfuhr innerhalb eines definierten Aktionsfelds und innerhalb eines Regel-Systems, z.T. auch jenseits gesellschaftlicher Vereinbarungen, Kontrollen und Sanktionen. "Helden" und "Heldinnen" sind immer in einem sozialen Feld "gefesselte Helden" (J. Nordalm) und insofern nur als dargestellte Figuren zu begreifen (G. Walther). Die entsprechenden Stilisierungen in Dokumenten, Bildern und Monumenten lassen sich in den Prozessen von Kontinuität und Kontrast, Wandel und Bruch, von manifester und latenter Überlieferung, von Projektion, Um- und Neubesetzung beschreiben. Geschichtlichkeit und Ambivalenz sind im elitären Begriff von "Heros" und "Held" unhintergehbar verankert. Signifikant für ihre Bedeutungsgeschichte sind: - Antworten auf Fragen der Moralität (gut – böse, richtig – falsch; Täter – Opfer) - Einschließen und Ausschließen (Ich, wir – die Anderen; das Besondere – das Allgemeine; typisch männlich – typisch weiblich) - Darstellung zwischen Realität und Idealität, Wirklichkeit und Fiktion (Mythos, Legende) - Propositionalität und Performanz im Unterschied der Geschlechter [Programm und Wirklichkeit in der traditionell männlich dominierten Zuschreibung / "Aufzeichnung" (I. Nierhaus)].

In der Praxis alltäglicher Verständigung und in den Medien sind "Heldin" und "Held" nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland zu Signalwörtern mit zunehmend diffuser Semantik, problematischer Verbindlichkeit und schwindender emotionaler Bindungskraft geworden. Semantischer Schwund spiegelt sich in ihrer Vervielfachung, ihrer begrenzten Haltbarkeit, in Austauschbarkeit und in der Unverbindlichkeit ihrer Anerkennung. Die Versuche zur Etablierung und Erhaltung bestimmter Bedeutungen gegen den langen geschichtlichen Prozess der Dekonstruktion waren und sind jeweils mit erheblichen Aufwendungen und Absicherungen (Ritualen, Propaganda, Gesetzgebung, Gewalt) verbunden. Zusammengefasst: Wenn Helden-Bilder Zeichen der Krise sind (J. Burkhardt, A. Toynbee), dann lassen sie sich als Figuren der Leit- und Streitkultur einer Gesellschaft interpretieren. Sie kommentieren die Bildungsideen ihrer Zeit.
