MEDIEN | (2 KB) 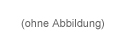 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Der Streik | |||||||||||||
| URHEBER OBJEKT | Koehler, Robert | |||||||||||||
| DATIERUNG | 1886 | |||||||||||||
| GEOPOSITION |  Google Maps Google Maps  OSM | 51.745228273865200 (NS), 8.712327182292938 (EW) (exakt) OSM | 51.745228273865200 (NS), 8.712327182292938 (EW) (exakt) | |||||||||||||
| INFORMATION | Der enorme wirtschaftliche Aufbau vor allem im Ruhrgebiet in den 50er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts löste das Problem des vormärzlichen Pauperismus, an dessen Stelle nun die "soziale Frage" des Industriezeitalters trat. Zu Beginn der Industrialisierung war die Verbindung zwischen Unternehmer und Belegschaft in vielen Betrieben durch ein patriarchalisches Verhältnis bestimmt: Der uneingeschränkten Unterordnung des Arbeiters stand die soziale Fürsorge des Arbeitgebers gegenüber. Der technische Fortschritt und das starke wirtschaftliche Wachstum führten zu ansteigenden Belegschaftszahlen und zum Aufbau einer streng hierarchischen Betriebsbürokratie. Zwangsläufig änderte sich damit auch die Sozialstruktur innerhalb der Unternehmen und hatte die Auflösung der alten patriarchalischen Selbstverpflichtung zur Folge. Gleichzeitig bildete sich eine nach unten stark gegliederte Arbeiterschaft heraus, deren Mehrheit bis über die Jahrhundertmitte unter extremen Verhältnissen, ohne soziale Sicherung und praktisch rechtlos lebte und arbeitete, und in ihren Lebensumständen klar von den Mittelschichten abgegrenzt war. Die wachsende Unzufriedenheit entlud sich zuerst im Bergbau. Vom 16.06.1872 bis zum 28.07.1872 kam es im Essener Kohlerevier erstmals zu einem organisierten Streik, an dem sich 14.885 Bergleute beteiligten. Den Ausbruch eines Arbeitskonfliktes zeigt auch das Bild von Robert Koehler (1850-1917). In Deutschland geboren, lebte und arbeitete Koehler überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika und machte sich dort als Genre-, Bildnis- und Landschaftsmaler einen Namen. Für sein Bild "Der Streik" wurde er 1889 auf der Weltausstellung in Paris und 1914 von der 'Minneapolis Art League' ausgezeichnet. Das Ölgemälde zeigt einen Ausschnitt aus einem Arbeitskampf in Belgien im Jahr 1886. Die Arbeiter rotten sich, nachdem sie ihre Beschäftigung niedergelegt haben, auf dem Gelände vor dem Haus des Fabrikbesitzers zusammen, dem der Sprecher der Streitenden im Namen der anderen seine Beschwerden vorbringt. Die Stimmung ist explosiv: Viele Männer gestikulieren zur Unterstreichung ihrer Worte heftig mit den Armen, und im Vordergrund hebt ein erster einen Stein vom Boden auf. Beschwörend spricht die Frau in der Mitte des Bildes auf den vor ihr stehenden Mann ein, während die Mutter, die sich mit ihren Kindern seitlich des Hauses aufhält, die Szene ängstlich beobachtet. Der Streik 1872 im Ruhrgebiet wurde von den am besten bezahlten Arbeitern - den Hauern - angeführt. Vordergründig galt er einer Gedingeerhöhung, der Verkürzung der Arbeitszeit sowie der Verbilligung des Hausbrandes, doch lag die eigentliche Ursache in der Unzufriedenheit der Arbeiter mit den sozialen Verhältnissen. Die Zechendirektoren und höheren Grubenbeamten, die häufig nicht aus Westfalen stammten, waren einzig und allein an geschäftlichen Erfolgen und Fortschritten interessiert, wogegen die alten, eingesessenen Bergleute den Verlust alter Knappschaftsprivilegien beklagten. Zusätzliches Konfliktpotential entstand durch eine neue Schicht von Lohnarbeitern, die aus dem Osten einströmten. Die einheimischen Bergleute, die in wirtschaftlichen Notzeiten durch Haus- und Grundbesitz, agrarische Nebeneinkünfte sowie Ersparnisse einigermaßen abgesichert waren, fühlten sich durch die Zuwanderer aus dem Osten sozial degradiert. Diese waren von Wirtschaftskrisen besonders betroffen, da sie ausschließlich von ihrem Lohn leben mußten. Sie bildeten bald in den schnell wachsenden Städten des Ruhrgebietes nach Meinung der Einheimischen das eigentliche Proletariat. Dieser erste organisierte Streik endete erfolglos, da den Arbeitern nach sechs Wochen die Mittel zur Fortsetzung der Arbeitsniederlegung fehlten. Doch war er insofern von Bedeutung, als er zur Gründung einer zentralen Bergarbeitergewerkschaft führte, da den Bergleuten bewußt geworden war, daß ihre bisherigen Organisationsformen nicht zur Durchsetzung berechtigter Forderungen genügten. In seiner letzten sozialpolitischen Schrift - dem "Arbeiterspiegel" von 1875 - wandte sich Friedrich Harkort noch einmal an die Arbeiter, um sie vor Streikverbindungen zu warnen; diese "schaden erfahrungsmäßig dem Arbeiter, (...). Die sogenannten Gewerkvereine, (...) sind großem Mißbrauch unterworfen, indem sie den Geist der alten Zünfte in neuer Form wiederherstellen wollen und den freien Willen der Genossen in Fesseln legen." [1]Harkort entwarf ein Berufsethos von der "Ehre der Arbeit", deren Grundlage jenseits aller gottgegebenen Differenzierung der gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung die Allgemeinheit der Bildung, das Recht und die Menschenwürde sei, und stellte dem Klassenkampfgedanken ein Leben in Ehre und Zufriedenheit innerhalb des eigenen Standes entgegen. Damit wandte er sich gegen die "Anmaßung der untern Klassen, sich für die unterdrückten Träger der Nationalwohlfahrt zu halten, und sich den übrigen Klassen feindlich gegenüber zu stellen." [2] Unverändert galt für Harkort der Führungsanspruch des Bürgertums in Staat und Gesellschaft. Die Lösung der Konflikte, die durch den Wandel zur Industriegesellschaft entstanden waren, sah er weiterhin in seinem in den 40er Jahren aufgestellten Programm der Integration des Vierten Standes in die bürgerliche Gesellschaft. Dabei verkannte Harkort, daß mit der Herausbildung der organisierten Arbeiterschaft eine neue Gesellschaftsschicht entstanden war, die eine neue politische Kraft werden sollte und neben sozialer letztlich auch politische Gleichberechtigung forderte. Die Worte Alfred Krupps, der selber ein Verfechter betrieblicher Sozialpolitik war und dessen Name später zum Sinnbild für die Entstehung und Entwicklung des Ruhrgebiets wurde, zeugen für die hohe Anerkennung, die Harkort aufgrund seines Wirkens als Industrieller und Sozialpolitiker von vielen seiner Zeitgenossen entgegengebracht wurde. Als Krupp den Arbeiterspiegel 1876 unter seinen Werksangehörigen verteilen ließ, bekannte er in einem Vorwort: "Schon vor 50 Jahren hat derselbe Mann und jetzt hochbetagte Greis viele Arbeiter beschäftigt; er war derjenige, der vor circa 45 Jahren zuerst den Puddelproceß in Deutschland, und zwar in Wetter an der Ruhr, einführte; trotz Kosten, Mühen und Gefahren. Hunderttausende von Menschen haben jetzt in Deutschland ihr Brod von dieser so wichtig gewordenen Industrie. Damals, als ich noch wenige Arbeiter beschäftigte, habe ich seinen Unternehmungsgeist bewundert und verdanke ihm und anderen großen Beispielen die Anregung zu eigenem Streben." [3] [1] Harkort, Arbeiterspiegel, S. 7. [2] Harkort, Arbeiterspiegel, S. 9. [3] Berger, S. 634. | |||||||||||||
| TECHNIK | Ölgemälde | |||||||||||||
| FORMAT | jpg | |||||||||||||
| QUELLE |  Killing, Anke | Friedrich Harkort | Dia 11, S. 37-40 Killing, Anke | Friedrich Harkort | Dia 11, S. 37-40 | |||||||||||||
| PROJEKT |  Diaserie "Westfalen im Bild" (Schule) Diaserie "Westfalen im Bild" (Schule) | |||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2004-02-24 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 2979 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 16 | |||||||||||||
 Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/med185 Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/med185 | ||||||||||||||
 zurück | zurück | Drucken / Speichern Drucken / Speichern Empfehlen Empfehlen Neue Suche Neue Suche Kommentar Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang Urheberrecht | Seitenanfang  | ||||||||||||||

