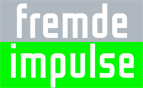Der Kokshochofen der St.-Antony-Hütte
Studienreisen nach Oberschlesien ermöglichten 1842 auf der Osterfelder St. Antony-Hütte den Bau eines ersten Kokshochofens im heutigen Ruhrgebiet.
© LVR-Industriemuseum, Oberhausen
Kapital zurück zur Auswahl
Ein Hochofen nach
Den ganzen Sommer des Jahres 1842 arbeiteten auf der Osterfelder St.-Antony-Hütte fünf Maurer, um aus 300.000 Ziegeln eine technische Innovation zu errichten. Die älteste Eisenhütte des Reviers bestand seit 1758, seither kannte man ihre großen Hochöfen. Dennoch war der Ofenneubau von 1842 offenbar so bemerkenswert, dass Pfarrer Johannes Terlunen in seiner Gemeindechronik festhielt, der neue Ofen sei entweder mit Koks, oder aber, wie bislang allein üblich, mit Holzkohlen nutzbar. Dieser Kokshochofen auf einer Fläche von fast 12 mal 12 Metern dürfte eine Höhe zwischen 13 und 16 Metern erreicht haben; da er bildlich nicht überliefert ist, können seine Höhe und auch das ungefähre Aussehen nur anhand vergleichbarer zeitgenössischer Hochöfen abgeleitet werden.
Zeichnungen und Bilder geeigneter Vergleichshochöfen sind aus Oberschlesien überliefert – weshalb aber der Blick auf gerade diese eisenschaffende Region? Den St.-Antony-Kokshochofen plante um 1840 die „Hüttengewerkschaft und Handlung Jacobi, Haniel & Huyssen (JHH)“, der spätere Weltkonzern „Gutehoffnungshütte (GHH)“ im heutigen Oberhausen. Das Know-how zum Hochofenprojekt hatte man seit den 1830er Jahren auswärts gesucht: Von Oberschlesienreisen brachte der JHH-Hütteningenieur Friedrich Kesten lange Verfahrensbeschreibungen mit, da man dort anders als an der Ruhr bereits seit 1789 Erfahrungen mit der Koksverhüttung sammelte. In Kestens Reisenotizen findet sich auch die Skizze eines Hochofens, der dem Grabungsfund auf St. Antony stark ähnelt.
Doch das Projekt eines Kokshochofens nach „schlesischer Art“ scheiterte an der 1842 aufziehenden Absatzkrise, der ungünstigen Verkehrslage der St. Antony-Hütte und letztlich wohl vor allem am fehlenden Detailwissen: Die spezielle feuerfeste Auskleidung gegen die hohen Temperaturen des Koksfeuers hat der Ofen nie erhalten. Um 1854 riss man ihn unbenutzt ab, da er dem Ausbau der Gießerei im Wege stand; auf St. Antony war nach 1842 kein Eisen mehr erschmolzen worden. Eine weit größere JHH-Kokshütte ging 1855 unmittelbar an der Köln-Mindener Eisenbahn in Betrieb. Die St.-Antony-Hütte, wo 1877 auch der Gießereibetrieb endete, kann heute als Außenstelle des LVR-Industriemuseums besichtigt werden.
Denkmale zum Impuls
Oberhausen - St. Antony-Hütte
Die St. Antony-Hütte ging als älteste Eisenhütte der Region bereits 1758 in ... weiter