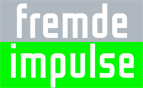Schloss Horst
Der Statthalter von Recklinghausen entschloss sich 1556 zum Bau eines der ersten und prachtvollsten Renaissanceschlösser im Ruhrgebiet und ließ sich von Bauwerken in ganz Europa inspirieren.
© Foto Dietrich Hackenberg
Kunst zurück zur Auswahl
Rüttger von der Horst baute eines der ersten Renaissanceschlösser im Ruhrgebiet
Rütger von Horst († 1581), Statthalter des Vestes Recklinghausen, entschloss sich zum Bau eines der ersten und prachtvollsten Renaissanceschlösser im Ruhrgebiet (Baujahr 1556 – 1578) und beauftragte Künstler und Kunsthandwerker aus ganz Europa.
Als die elterliche Burg bei einem Brand bis auf die Außenmauern zerstört wurde, ließ Rütger von Horst einen neuen Familiensitz aufbauen. Auf seiner Kavalierstour durch Frankreich hatte er neuartige Schlösser, die nach einheitlichem Plan gestaltet worden waren, kennengelernt. Wie dort sollte auch bei dem Neubau nichts mehr an eine bis dahin typische, vom Wehrcharakter geprägte Wasserburg erinnern. Zwischen 1554 und 1573 entwarfen und bauten Baumeister, Künstler, Kunsthandwerker und Handwerker aus ganz Europa das neue Schloss in Horst (heute zu Gelsenkirchen) und schufen so ein Gesamtkunstwerk in der Formensprache der Spätrenaissance.
Arndt Johannsen to Boecop, Stadtbaumeister in Arnheim, entwarf das Hauptschloss nach dem Vorbild französischer Kastell-Architektur als Vierflügelanlage mit quadratischem Grundriss und vier leicht vorgeschobenen Ecktürmen. Über Eck ordnete er nach Norden zwei mehrgeschossige Gebäude an, auf die nach Süden hin zwei niedrigere, lediglich eingeschossige, antworteten.
In niederländischer Manier ließ to Boecop im Nordostflügel ein repräsentatives zentrales Treppenhaus bauen. Diese vertikale Erschließung eines Gebäudes durch ein großzügiges Treppenhaus mit repräsentativen Stufenbahnen und einem Umkehrpodest auf halber Geschosshöhe war ein weiteres Novum in der westfälischen Architektur jener Zeit. Im übrigen Westfalen erschlossen noch über viele Jahre Wendeltreppen die einzelnen Geschosse. Meist wurden die Treppentürme, sogenannte Wendelsteine, den Fassaden vorgelagert oder in die Hofecken eingestellt.
Die Binnenstruktur von Schloss Horst hat italienische Wurzeln: Nach dem Vorbild italienischer Palazzo-Architektur erschloss to Boecop die Innenräume in den beiden mehrstöckigen Hauptflügeln durch hofseitig vorgelagerte Galeriegänge. Auf diese Weise gelang es dem niederländischen Baumeister erstmalig in Westfalen in einem Schloss Verkehrswege und Wohnbereiche konsequent voneinander zu trennen. Wegen der rauen klimatischen Bedingungen im Ruhrgebiet waren die Galerien in Horst aber durch große bleiverglaste Fenster geschlossen.
Auch die Bauskulptur und –ornamentik war seinerzeit in Westfalen ungewöhnlich und ohne Vorbild. Arnt Johannsen to Boekop brachte die ornamentale wie skulpturale Gestaltungsfreude des niederländischen Manierismus aus seiner geldrischen Heimat nach Horst. Laut Bauakten nahm er 1557 dort seinen Dienst auf und schuf in gut zehn Jahren zusammen mit Meistern wie Henrich und Wylhelm Vernukken (Vater und Sohn) aus Kalkar oder Laurentz von Brachum aus Wesel die aufwändig verzierten Fassaden. Auch die Innenausstattung wie die fein gearbeiteten Türgewände und vermutlich auch die großen Bildkamine aus Baumberger Sandstein gehen auf diese Künstler zurück.
Der Aufschwung des Buchdrucks ermöglichte neue Möglichkeiten der architektonischen Gestaltung. Reich illustrierte Architekturtraktate von Leon Battista Alberti (1404-1472), Sebastiano Serlio (1475-1554) oder die antiken Schriften des römischen Architekten und Architekturtheoretikers Vitruv (1. Jahrhundert v. Chr.) wurden nun europaweit verbreitet und auf Baustellen als Vorbilder genutzt. Auch bei den Horster Fassaden hielt man sich selbstverständlich an die Abfolge eines antiken Säulenkanons. Ebenso fanden zwei Satyrn eines Holzschnitts aus der Rivius-Ausgabe des Vitruv Eingang in die Dekoration der Hoffassade des Herrenhauses von Schloss Horst. Für die gesamte Bandbreite von Architekturteilen lagen seit der Renaissance europaweit verbreitet Druckgrafiken mit Vorschlägen für Verzierungen vor.
Bereits vor seiner Fertigstellung war der Horster Schlossbau Vorbild für Bauten der näheren Umgebung. So realisierte Wilhelm Vernukken von 1569–1573 die Kölner Rathauslaube nach einem Entwurf von Cornelis Floris. Mit dem Namen Laurentz von Brachum verbindet sich eine ganze Reihe von Schlossbauten im Lipperaum. Seine Schöpfungen stellen eine selbständige Weiterentwicklung von Schloss Horst dar. Diese besondere Form von Anlage und Dekoration, die bis in das zweite Viertel des 17. Jahrhunderts vorhält, rechtfertigt es, von der „Lipperenaissance“ oder einer „Lippeschule“ zu sprechen. Doch weder in der architektonischen Konzeption noch der dekorativen Ausstattung reichte einer der Nachfolgebauten qualitativ an das Horster Vorbild heran.
Denkmale zum Impuls
Gelsenkirchen - Schloss Horst
Rütgers gesellschaftlicher Aufstieg im Dienste seines Landesherren, des kölnischen ... weiter
Gelsenkirchen - Renaissance-Kamine
In Schloss Horst befanden sich ursprünglich mindestens neun mit bildlichen Darstellungen ... weiter