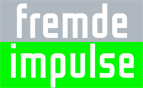Die Henrichshütte in Hattingen-Welper
Werksstraße 31–33 • 45527 Hattingen
Gebaut wurden die Öfen der Henrichshütte von dem Belgier Gobiet und seinem Team. Eine Gruppe erfahrener Hüttenleute aus dem Harz nahm sie in Betrieb. Die Henrichshütte wuchs über Jahrzehnte zu einem Betrieb von überregionaler Bedeutung.
© Dietrich Hackenberg
Kapital zurück zur Auswahl
Ein Graf aus dem Harz investiert an der Ruhr
1854 begann der Aufbau der Henrichshütte im Ruhrtal bei Hattingen; Graf Henrich zu Stolberg-Wernigerode gab dem Werk nicht nur seinen Namen, er stellte auch das erforderliche Kapital und warb Fachleute in seiner Harzer Heimat an. Das Wissen um die Technologie der Koksverhüttung kaufte der Graf allerdings in Belgien ein: Von dort kamen Joseph Gobiet und seine Fachleute, die 1854/55 den Bau des Hochofenwerks für die Koksverhüttung realisierten, welche sich im Ruhrgebiet zu diesem Zeitpunkt erst zu etablieren begann. 1855 konnte die Roheisenerzeugung auf der Henrichshütte aufgenommen werden; schon 1856 wurde ein zweiter Kokshochofen angeblasen, noch zwei weitere folgten 1859 und 1860. Bis zur Übernahme durch den Lokomotivbauer Henschel 1904 wechselte das Integrierte Hüttenwerk mit seiner Kokserzeugung, Roheisen- und Stahlproduktion sowie einer wachsenden Zahl von weiterverarbeitenden Betrieben gleich mehrfach den Besitzer. Phasen der Unterfinanzierung hemmten dabei bis 1904 wiederholt die Entwicklung der Hütte.
Die Hütte wuchs dennoch über Jahrzehnte zu einem Werk von überregionaler Bedeutung. Der erhaltene Hochofen III wurde 1939 errichtet, ein weiterer in der Rüstungskonjunktur vor dem Zweiten Weltkriegs geplanter Ofen IV kam nicht mehr zur Ausführung. Der im Zuge der Neuzustellungen (Generalüberholungen) mehrfach modernisierte Ofen wurde wie das gesamte Hüttenwerk Ende 1987 stillgelegt. Während weite Teile des Hochofenbetriebes der Henrichshütte nach China verkauft wurden, konnte das LWL-Industriemuseum den Ofen III wie auch seine Nebenaggregate erhalten. Auch die große Gebläsemaschinenhalle – heute Schauplatz der Dauerausstellung – aus den 1890er Jahren sowie das Gebäude des Bessemer-Stahlwerks, das hier ab 1873 nur für kurze Zeit betrieben wurde, sind erhalten und dokumentieren die lange Geschichte der Eisen- und Stahlerzeugung, die mit Harzer Fachleuten 1855 begann.