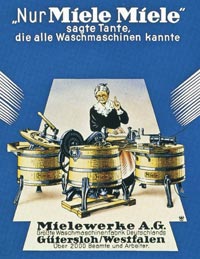Obgleich im Bewusstsein der meisten Benutzer von Miele-Geräten die Firma mit der Stadt Gütersloh verbunden wird, ist das Unternehmen nicht dort, sondern im benachbarten Herzebrock im Jahre 1899 gegründet worden. Carl Miele und Reinhard Zinkann gründeten dort eine "Centrifugenfabrik" mit elf Mitarbeitern. Die Milchzentrifugen waren keine Innovation, allein im weiteren Umkreis von Herzebrock gab es bereits 31 Konkurrenten. Um sich ihnen gegenüber durchsetzen zu können, verwirklichten die Gründer ein Konzept, das bis heute das Unternehmen prägt: Sie setzten auf Qualität unter dem Firmenmotto: "Immer besser". Dieses Konzept war erfolgreich. Ebenso eine weitere Geschäftsidee, die Produktdiversifizierung. Schon 1900 wurden Buttermaschinen in das Programm aufgenommen. Deren Technik ließ sich auch in den im gleichen Jahr erstmals gefertigten Holzbottichwaschmaschinen einsetzen. Damit wurden zwei Produktlinien aufgenommen, die die Firmengeschichte prägen sollten: Maschinen für die Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und zur Erleichterung der Hausarbeit.
Miele & Cie. – Familienunternehmen und Weltfirma
1907 wurde die Firma nach Gütersloh verlagert. Gründe dafür waren die aktive Gewerbeansiedlungspolitik der Stadt, die Bereitstellung von Betriebsflächen mit Verkehrsanschluss (vor allem an die Eisenbahn) und bessere Rekrutierungsmöglichkeiten für die wachsende Arbeiterschaft, die von 60 im Jahre 1907 auf 600 beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs anstieg, um dann 1929 die Zahl 2.100 zu erreichen. Mitten im Krieg, 1916, wurde in Bielefeld ein neues Werk errichtet, das eine weitere Produktlinie aufnahm: die Herstellung von Transportmitteln, nämlich von Fahrrädern. Miele wollte sich die Kompetenz der Bielefelder Arbeiterschaft auf diesem Gebiet zunutze machen. Ein Versuch, im Werk Gütersloh auch Autos zu bauen, wurde 1913 nach nur einem Jahr und 143 gebauten Exemplaren wieder eingestellt. Nach langer Suche wurde 1996 ein Miele-Auto in einer Scheune in Norwegen entdeckt, liebevoll restauriert und im Miele-Museum in Gütersloh ausgestellt.
Schon in diesen Anfangsjahren werden die Grundzüge der 115-jährigen Geschichte des Unternehmens sichtbar: Die Innovationskraft, mit der immer wieder neue Produkte entwickelt werden, genauso aber auch die Fähigkeit, siehe Auto, Produkte wieder aufzugeben, wenn sich der Markt als nicht ausreichend herausstellt. So lassen sich innerhalb dieser einen Firma Produktsequenzen verfolgen, wie sie für ganze Industriestädte, z.B. für Bielefeld (Knübel 1981), erarbeitet worden sind, dort allerdings in der Abfolge verschiedener Betriebe. Überblickt man die Firmengeschichte von Miele, so kann man nur staunen darüber, was dort alles schon mal produziert worden ist: von Schweinetränken, Eisschränken, Bügeleisen, Motorrädern, Melkmaschinen über fahrbare Kartoffelkäferspritzen bis hin zum unverwüstlichen Handwagen aus Holz, dem legendären "Bollerwagen", der die Transportprobleme der regionalen Bevölkerung während und zwischen den Weltkriegen erleichterte. Getragen wurde dies durch eine gut ausgebildete Arbeiterschaft, die sich mit dem Werk immer identifizierte, wovon die Eigenbezeichnung "Mieleaner" ebenso zeugt wie die Zahl von ca. 11.000 Jubilaren (Stand 2012), die 25 Jahre oder länger beschäftigt waren. Dieses "Wir-Gefühl" war im Stammwerk Gütersloh stärker ausgeprägt als im Zweigwerk Bielefeld (Klessmann 1982), wohl weil hier das patriarchalische Verhältnis zwischen den Unternehmerfamilien und der Arbeiterschaft charakteristischer war (Werkswohnungsbau und dergleichen).
Das Unternehmen wird heute in der vierten Generation von den Urenkeln der Gründer geleitet. Die Aktien werden zu 51% von der Familie Miele, zu 49% von den Zinkanns gehalten. Die Eigenkapitalquote ist ungewöhnlich hoch. Ausgeklügelte Verträge haben bisher das Schicksal zahlreicher Familienunternehmen verhindern können, die sich spätestens in der dritten Generation auflösten. Diese Verträge sehen z.B. vor, dass die Hälfte des (geheimgehaltenen) Gewinns wieder in die Firma investiert werden muss.
Der heutige Konzern Miele beschäftigte am 30.06.2017 weltweit knapp 19.500 Mitarbeiter und erzielte im selben Geschäftsjahr einen Umsatz von 3,93 Mrd. Euro (Die Glocke, 11.08.2017). Miele produziert an folgenden Standorten (Stand 2014):
- Im Stammwerk in Gütersloh sind 5.300 Mitarbeiter tätig (Stand 2014). Hier befinden sich die Hauptverwaltung und das Warenverteilzentrum. Im Werk werden Waschautomaten und Wäschetrockner hergestellt. Hier wird auch die Elektronik gebaut, die heute ein fester Bestandteil moderner Haushaltsmaschinen ist. Dass Miele seine Elektroniksteuerungen selbst herstellt, ist ein Rest der früheren Firmenphilosophie, möglichst alles Zubehör im eigenen Haus zu erzeugen. Nur so glaubte man, die hohen Qualitätsansprüche erfüllen zu können.
- Das Werk Bielefeld (1.776 Mitarbeiter; Stand 2013) stellte um 1960 die Produktion von Motorrädern und Fahrrädern ein und konzentriert sich heute auf die Herstellung von Geschirrspülern, Staubsaugern und Desinfektoren. Miele baute übrigens bereits 1929 als erste Firma in Europa Geschirrspülmaschinen.
- Das Werk in Euskirchen war nach langer Pause 1950 das erste neue Zweigwerk. Heute (Stand 2014) stellen dort 410 Mitarbeiter Elektromotoren und Kabelrollen für alle Geräte des Konzerns her.
- Das Werk in Bürmoos bei Salzburg in Österreich baute Miele ab 1962 auf, um ein Standbein in der EFTA zu haben. 270 Mitarbeiter (Stand 2014) bearbeiten dort hauptsächlich Edelstahl für Komponenten, die in den anderen Werken eingebaut werden, sowie Sterilisatoren.
- 1965 erwarb Miele von der weichenden Firma Gillette ein Firmengelände in Lehrte bei Hannover. Die Mitarbeiter wurden weitgehend übernommen, neue Gebäude errichtet und die Produktion der 380 Beschäftigten (Stand 2014) auf Wäscherei- und Bügelmaschinen konzentriert.
- 1960 erkannte Miele, dass die Kunden nicht nur einzelne Küchengeräte, sondern ganze Kücheneinrichtungen wünschten. Ab 1972 errichtete Miele in Warendorf eine völlig neue Produktionsstätte für diesen Bereich. Da sich die Produktion kompletter Küchen aber nicht rechnete und dieser Zweig nur noch zwei Prozent zum Umsatz des Gesamtkonzerns beitrug, verkaufte Miele die Küchenproduktion 2005 an ein Schweizer Unternehmen. Im Werk Warendorf werden aber weiterhin von 240 Mitarbeitern (Stand 2014) 60% aller Spritzgussteile (Kunststoffteile) für den gesamten Konzern erstellt. Außerdem befindet sich dort das Ersatzteillager.
- 1986 kaufte Miele den Mitbewerber Cordes in Oelde auf und stellte die Produktion auf Herde und Backöfen um. Dort sind heute 640 Mitarbeiter beschäftigt (Stand 2014).
- Ähnlich ging der Gütersloher Konzern 1989 vor, als er die Firma Imperial in Bünde erwarb. Der Firmenname Imperial wurde zunächst als Zweitmarke genutzt, ist aber heute aufgegeben. Die 550 Mitarbeiter (Stand 2014) in Bünde stellen Dampfgarer und Kochfelder her; Dunstabzugshauben werden im ehemaligen Imperial-Zweigwerk in Arnsberg gebaut.
- Im Jahr 2009 errichtete Miele eine Produktionsstätte im rumänischen Braşov, in der rd. 200 Beschäftigte Elektronikkomponenten u.a. für Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen und Staubsauger fertigen (Stand 2014).
- Seit 2013 hat Miele die Hälfte seiner Wäschetrockner-Fertigung in das Werk Unicov (Tschechien) verlegt.
- Bis Ende 2000 hat Miele zusammen mit Melitta in einem Werk in der südchinesischen Provinz Guangdong Staubsauger produziert. Dieses Werk führt Miele allein weiter. 450 Mitarbeiter fertigen pro Jahr etwa 600.000 Staubsauger.
Miele ist heute bei den Produktgruppen Waschmaschinen und Staubsauger die Nr. 1 in Europa, zugleich die einzige weltweit verbreitete Premium-Marke für Hausgeräte. 70% des Umsatzes werden im Ausland getätigt (Stand 2017). Dort ist Miele auf allen Kontinenten durch Verkaufsbüros vertreten. Wachstumsmärkte sieht man vor allem in Russland und Südamerika. Trotz des starken Auslandsanteils ist die Firma in Westfalen verwurzelt. Die Geschäftssprache innerhalb des Konzerns ist Deutsch. Abbildung 2 zeigt die Ausrichtung der Zweigwerke auf das Stammwerk in Gütersloh, auf die man bei Miele stolz ist und die man beibehalten will. Westfälische Beständigkeit eben.
Die Firmenphilosophie des "Immer besser" wurde konsequent bis heute durchgehalten. Die Gesellschaft für Konsumgüterforschung hat ermittelt, dass Miele-Waschmaschinen im Durchschnitt 18,5 Jahre, Wäschetrockner 18,6 Jahre genutzt werden. Der Durchschnitt der Mitbewerber liegt bei 12,4 bzw. 11,8 Jahren. Dementsprechend ist auch die Wiederkaufsrate bei Miele-Geräten außerordentlich hoch: 90% der Käufer von Miele-Geräten würden ein Gerät dieser Firma wieder kaufen.
Die konsequente Ausrichtung auf das Hochpreissegment hat ihren Preis: Sie kollidiert mit der Geiz-ist-geil-Mentalität der Kunden. Zudem ist der Markt für Haushaltsgeräte weitgehend gesättigt.
Besonderes Wachstum erzielt Miele in den USA, Australien, Kanada und Asien. Mit der neu gegründeten Tochter Miele Venture Capital GmbH engagiert sich das Unternehmen im zukunftsträchtigen Bereich der vernetzten Hausgeräte (Smart Home).
Das Geschäftsjahr 2016/17 zeigt mit einem Gesamtwachstum des Umsatzes von 5,9% positive Zahlen. Der Umsatz wuchs in Deutschland um 6,8% auf 1,18 Mrd. Euro, womit der deutsche Anteil am Gesamtumsatz rund 30% beträgt. 2017 beschäftigt die Miele-Gruppe in Deutschland knapp 11.000 Menschen.
Miele geht weiter auf dem Weg des "Immer besser".
Weiterführende Literatur/Quellen
| • |
Die Glocke vom 15.08.2014: "Miele-Umsatzrekord beruht auf Inlandsgeschäft" |
|
| • |
Die Glocke vom 11.08.2017: "Miele punktet mit Einbaugeräten und Staubsaugern" |
|
| • |
Klessmann, C. (1982): Politisch-soziale Traditionen und betriebliches Verhalten von Industriearbeitern nach 1945. |
|
| • | Knübel, H. (1981): Die Industrieentwicklung in alten Textilindustriestädten am Beispiel Wuppertal, Mönchengladbach, Krefeld und Bielefeld. Wuppertal, S. 87-117 (= Wuppertaler Geographische Studien, Nr. 2) | |
| • |
Miele & Cie (Hg.) (1999): 1899-1999 - 100 Jahre Miele im Spiegel der Zeit. Gütersloh |
|
| • |
www.miele.de/haushalt/standorte-447.htm#item-2-2 |
|
| • |
www.miele.de/media/misc_de/media/files/infomaterial/Miele_GB_2013-14_DE_web.pdf |
Erstveröffentlichung 2007, Aktualisierungen 2014, 2017