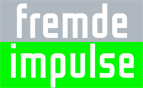Die Scheidtsche Tuchfabrik an der Ruhr
Ruhrstr. 87–89 • 45219 Essen-Kettwig
Die umgenutzt erhaltene Fabrik geht auf das Jahr 1837 zurück.
© Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln
Kapital zurück zur Auswahl
Zwischen 1837 und 1911 bebaute die Firma weite Teile des Kettwiger Ruhrufers
Wenngleich sich mit dem Erwerb der ersten Vorspinnmaschine schon in den Manufakturgebäuden an der Kirchfeldstraße das „Maschinenzeitalter“ angekündigt hatte, sollte der eigentliche Durchbruch des Fabrikwesens in Kettwig erst 1837 mit Inbetriebnahme der Anlagen am Ruhrufer erfolgen. Hier wurde mit Dampf- und später auch mit Wasserkraft produziert, während im Kirchfeld erste Versuche mit einem Pferdegöpel (ein Pferdeantrieb) zur zentralen Krafterzeugung noch gescheitert waren. Erst in der neuen Fabrik am Ruhrufer wurden zudem alle Verarbeitungsschritte konzentriert, mit dem Aufstellen mechanischer Webstühle war nun die Vergabe der Webarbeiten in Heimarbeit überflüssig.
Die Bausubstanz des erhaltenen und für die Wohnnutzung entkernten Fabrikgebäudes stammt im Wesentlichen aus der Zeit nach 1902, da die Fabrik nicht nur mehrfach erweitert, sondern nach verheerenden Bränden insbesondere 1880 und 1902 stark verändert wurde. Das 1902 angebaute Turbinenhaus war ursprünglich mit drei Turbinen ausgestattet, die die Wasserkraft der Ruhr nutzten. Die Gebäude bieten aufgrund ihrer Baugeschichte eine Mischung aus der eher klassizistischen Formensprache der Anfangsjahre um 1837 und historisierenden Elemente der Zeit um 1902, die insbesondere dem repräsentativen, stadtseitigen Turbinenhaus einen Hauch von „Burgenarchitektur“ geben.
Neben den teilerhaltenen ausgedehnten Sheddachhallen der Scheidtschen Kammgarnfabrik, die 1911 entstanden, befindet sich an der Ringstraße 17-27 das ehemalige „Mädchenheim“ der Tuchfabrik J. W. Scheidt: Hier waren ab 1906 bis zu 280 meist junge und ledige Arbeiterinnen der Fabriken untergebracht. Sie stammten zu einem guten Teil aus Ost- und Westpreußen und übernahmen vielfältige Aufgaben in den Fabriken, deren Belegschaften wie überall in der Textilindustrie mehrheitlich aus Frauen bestanden. Die dreigeschossige Dreiflügelanlage mit Mansarddach wurde 1927 noch um zwei Pförtnerhäuschen erweitert. Das ehemalige Wohnheim dient heute Wohn- und Gewerbezwecken.